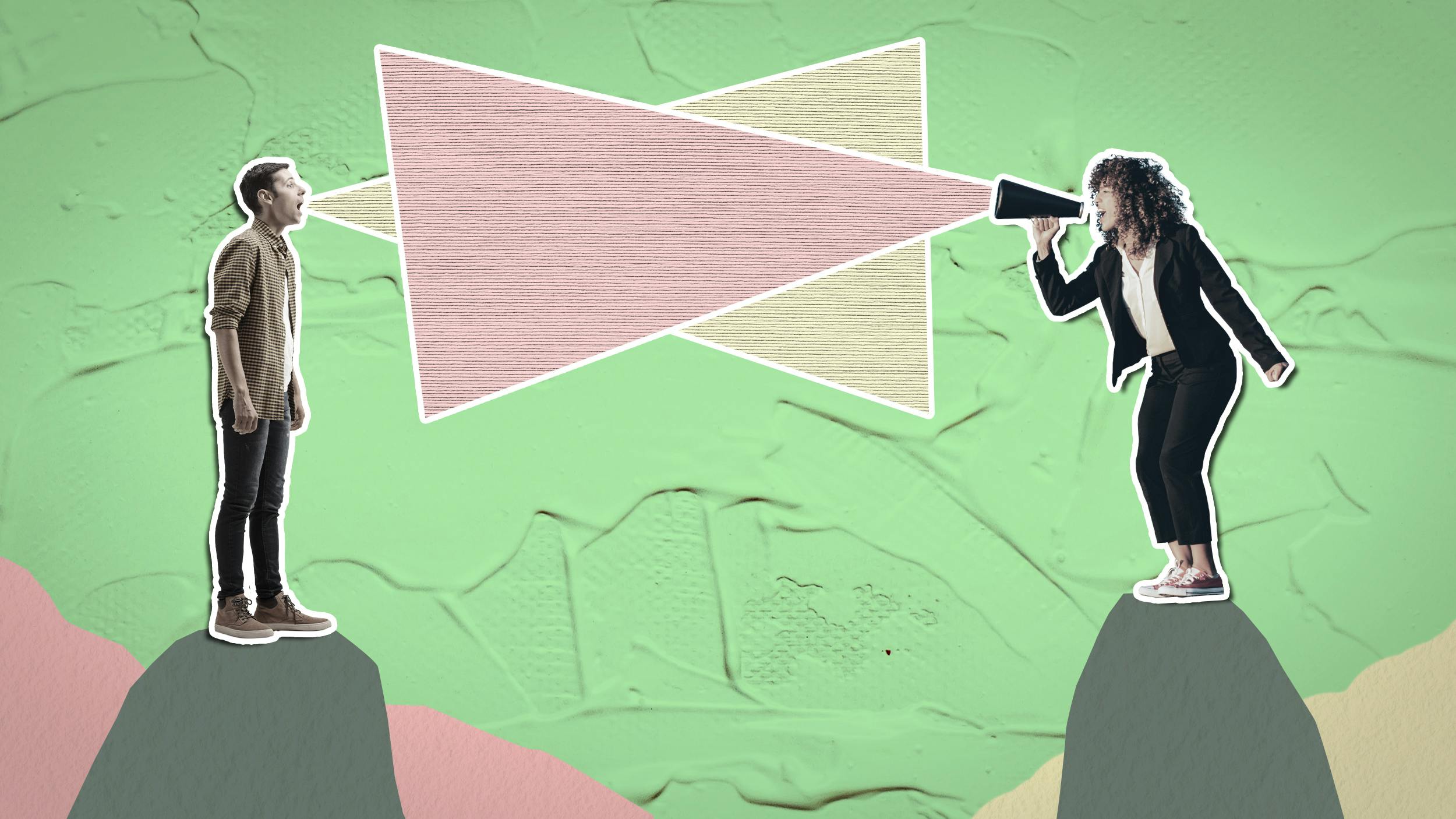Wenn ich an einen Tag im Jahr 2015 zurückdenke, habe ich immer noch ein schlechtes Gewissen. Ich lebte in Jena. Die Stadt war ein studentisches Paradies mit einer großen alternativen Szene, die sich immer wieder gegen die Rechtsextremen aus dem Thüringer Umland gewehrt hat. Gleichzeitig war Jena damals ziemlich weiß. Mein Name war außergewöhnlich und ich wurde oft darauf angesprochen.
Um meinen Personalausweis zu verlängern, musste ich ins Bürgeramt. Ich saß auf einer der Bänke, hatte Kopfhörer auf und ging in Gedanken meine nächsten Tage durch. Mein Rucksack mit Laptop und Unizeug lag neben mir auf der Bank. Plötzlich setzte sich eine Frau neben mich, zwei Kinder im Schlepptau und ein Kopftuch auf. Ich zuckte zusammen und griff nach meinem Rucksack, aber nicht, um ihn wegzuräumen, denn Platz war genug, sondern weil ich in dieser Sekunde dachte: „Nicht, dass die etwas klauen.“
Es dauerte eine Sekunde, bis mir klar wurde, was gerade passiert war. Meine Vorurteile hatten mich so handeln lassen. Bis heute schäme ich mich dafür, wie ich mich damals verhalten habe. Auch dafür, was ich bei der Frau ausgelöst haben könnte.
Ich bin in Wuppertal aufgewachsen. Wuppertal hat einen Ausländeranteil von über 40 Prozent. In meiner Grundschulklasse war ein Schwarzer Junge, Menschen mit einem türkischen Elternteil, zwei türkischen Elternteilen, Familien, die aus Russland und Polen kamen. Im Restaurant meines Vaters habe ich mit Syrern, Jordaniern, Marokkanern zu tun gehabt. Für mich war es normal, wenn Menschen schwarze Haare hatten, gekräuselte Locken oder blond waren und trotzdem eine Migrationsgeschichte hatten. Warum also bin ich an diesem Tag zusammengezuckt? Bin ich Rassist?
Wenn Menschen sich treffen, treffen auch Wissen und Vorurteile aufeinander. Die Debatten, wie wir mit solchen Situationen umgehen sollten, sind heute aufgeheizt.
Denn das Dilemma ist so groß wie nie: Einerseits wollen wir „die Guten“ bleiben und trotzdem wird es Situationen geben, in denen rassistische Mechanismen unser Denken und Handeln bestimmen. Können wir dieses Dilemma auflösen? Können wir das Unwohlsein normalisieren, ohne den dahinterliegenden Rassismus zu reproduzieren?
Täter und Opfer gleichzeitig
Ich weiß nicht, ob die Frau meinen Griff nach dem Rucksack bemerkt hat, ich kann nicht sagen, was es in ihr ausgelöst hat. Bestimmt hat sie die Szene längst vergessen. Nur in meinem Kopf spukt sie noch herum.
Denn sie erinnert mich daran, wie ich behandelt werde, wenn es um meinen eigenen Migrationshintergrund geht, auch wenn ich meine Erfahrungen nicht mit denen einer Frau mit Kopftuch gleichsetzen möchte. Trotzdem gibt es dann einen Satz, der mich bis heute sofort in Eskalationsstimmung versetzt: „Aber du siehst gar nicht arabisch aus.“
Dieser Satz fällt meistens kurz, nachdem ich erklärt habe, woher ich meinen Namen habe. Ich rassele das inzwischen nur noch herunter. „Vater aus Syrien; Mutter ist aber deutsch; nein, ich spreche kein Arabisch; ich war das letzte Mal mit sechs Jahren in Syrien; ja, ich habe noch Verwandtschaft dort, aber keinen Kontakt.“ Das ist der Rahmen, den ich in 34 Jahren als „Tarek Barkouni“ für interessierte Menschen gebastelt habe.
Auf den Satz, der danach folgt, habe ich keine endgültige Antwort gefunden. Als Jugendlicher habe ich noch gelacht und auf meine weißblonde Kindheit verwiesen. Später wurde daraus ein Achselzucken und heute ist es die spitzfindige Frage: „Wie sehen Araber:innen denn normalerweise aus?“
So harmlos dieser Satz auch sein mag, mich regt die Ignoranz der Aussage über das arabische Aussehen furchtbar auf. Aber sollte er das überhaupt? Muss ich das Wissen voraussetzen, dass im Nahen Osten auch blonde Menschen leben? Oder gehören solche Missverständnisse in einer diversen Gesellschaft einfach dazu? Ist es unfair, wenn ich so hart auf den Satz reagiere? Wo ich doch selbst schon Rassismus reproduziert habe?
Wie viele sind wir?
Anfang 2022 lebten in Deutschland 22,3 Millionen Menschen „mit Migrationshintergrund“, waren also entweder selbst im Ausland geboren oder haben mindestens einen Elternteil, der die deutsche Staatsangehörigkeit nicht durch Geburt besitzt. Ich bin einer von ihnen. Wir stellen ein Viertel der gesamten Bevölkerung, wir sind Doktor:innen, wir sind Journalist:innen, wir arbeiten in der Küche, wir schaffen für Mercedes, wir kümmern uns um Kinder oder sind auch mal arbeitslos. Und trotzdem bleiben wir „Menschen mit Migrationshintergrund“, eine unförmige Masse bestehend aus Menschen aus fast jedem Land der Erde.
Wir werden die meisten der 22,3 Millionen Menschen vermutlich niemals kennenlernen, vielleicht nicht einmal bemerken, weil sie nicht nach „Migrationshintergrund“ aussehen. Aber wir gehören nunmal zu Deutschland.
Mein Kollege Benjamin Hindrichs hat es hier bereits erklärt: Wir leben in einem Einwanderungsland. In einem, das diese Tatsache noch nicht vollständig akzeptiert hat. Denn dazu gehört auch, dass es zu Widersprüchen, zu Missverständnissen, zu Fehlern und Streit kommt. Die gute Nachricht: Immerhin 77 Prozent der Deutschen stimmen laut einer Studie der Bertelsmann-Stiftung zu, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei. Und auch Menschen mit Migrationshintergrund fühlen sich größtenteils in Deutschland wohl.
Gleichzeitig zeigt der Afro-Zensus von 2020 aber auch, dass Schwarzsein in Deutschland immer noch mit Diskriminierungserfahrungen einhergeht. So berichten knapp 56,5 Prozent, gefragt zu werden, ob sie Drogen verkaufen. Gleichzeitig werden ihnen rassistische Erfahrungen abgesprochen. Und die Leipziger-Autoritarismus-Studie von 2018 zeigt, dass 44 Prozent der Befragten der Ansicht sind, dass Muslim:innen die Zuwanderung nach Deutschland verboten werden sollte und mehr als die Hälfte der Befragten sich wegen Muslim:innen „fremd im eigenen Land“ fühle.
Denn egal, für wie weltoffen und vorurteilsfrei wir uns halten, am Ende sind wir Opfer unserer eigenen Gehirne, die voll von Schubladen und erlernten Mustern sind. Auch, wenn wir zu den Guten zählen wollen. Es waren nette Bekanntschaften unter denen, die mir gesagt haben, ich würde nicht wie ein Araber aussehen. Und ich als Tarek habe nach meiner Tasche gegriffen.
Wie wir über Vorurteile sprechen
Damit bin ich nicht alleine. Denn die Wahrheit ist auch: Vorurteile sind als Affekthandlungen menschlich und liegen tief verankert in unserem Zusammenleben – nicht nur in Deutschland.
In „Kleine Einführung in das Schubladendenken: Über Nutzen und Nachteil des Vorurteils“ beschreibt der Sozialpsychologe Jens Förster, wie unser Gehirn und unsere Gesellschaft Vorurteile erst entwickeln – und dann zur Arbeitserleichterung nutzen.
13 Jahre später hat er das Buch nochmal neu aufgelegt oder besser gesagt, komplett neu geschrieben: „Schublade auf, Schublade zu: Die verheerende Macht der Vorurteile“ heißt es nun. Darin beschreibt er, wie Vorurteile entstehen:
„Unser Langzeitgedächtnis speichert Emotionen, die mit bestimmten Verhaltensweisen oder sozialen Gruppen zusammenhängen. Das erlaubt es uns, schnell auf Eindrücke von außen zu reagieren.“ Ganz einfach: Ich bin als Radfahrer besonders oft von SUVs geschnitten worden, deshalb halte ich jetzt SUV-Fahrer:innen für schlechte Menschen. Ein Vorurteil ist geboren. Dabei müsste ich die Erfahrung nicht einmal selbst machen. Obwohl ich quasi nie Kontakt mit Hunden hatte, bin ich als Kind zum Beispiel regelmäßig vor Angst ausgeflippt, einfach, weil mein Vater selbst sehr große Angst hatte und mir beigebracht hat: Hunde sind gefährlich. Dieses Vorurteil habe ich übernommen.
In der psychologischen Forschung war man lange davon ausgegangen, dass diese gespeicherten Emotionen etwas Pathologisches, also Krankhaftes sind. Eine Fehlentwicklung im Gehirn. Erst mit der weiteren Entwicklung der Vorurteilsforschung wuchs die Erkenntnis, dass Vorurteile beinahe unvermeidbare Merkmale unserer Gesellschaft sind. Nach der Theorie der sozialen Dominanz spiegeln sich zum Beispiel auch Machtverhältnisse in Vorurteilen wieder.
Deswegen ist es auch so schwer, Vorurteile nachhaltig zu verändern. Weil Vorurteile jahrelang dabei geholfen haben, die Welt zu erklären, schreibt Förster, höre unser Gehirn nicht einfach damit auf. Es brauche Zeit und bedürfe einiger Arbeit an sich selbst, um spontane negative Reaktionen durch positive zu ersetzen. „Selbst wenn man den festen Willen hat, dauert es, ein Vorurteil zu zertrümmern.“
Unser Gehirn sei erstaunlich gut darin, solche Strukturen aufrechtzuerhalten. Selbst wenn eine Person unserem Vorurteil nicht entspreche, mache sie unser Gehirn zur Ausnahme der Regel und übertrage das Vorurteil dann auf die nächste betroffene Person, die in dieses Vorurteil passt.
Förster nennt dieses Denken „Pseudowissensstrukturen“, die im Langzeitgedächtnis festhängen. Obwohl dieses Wissen ständig angewendet und getestet werde, stimme es in den seltensten Fällen mit der Realität überein. Ich sehe nicht nach Syrien aus und die Frau mit Kopftuch war keine Taschendiebin. Trotzdem löscht das vorurteilsbehaftete Gehirn auch nach dem Zusammentreffen die Vorurteile nicht einfach aus.
Es ist also menschlich, rassistisch zu handeln. Und trotzdem ist diese Rechtfertigung für unsere Gesellschaft gefährlich. Denn für Betroffene ist es eine ständige Belastung, mit Vorurteilen konfrontiert zu werden. Eine so starke Belastung, dass das Risiko für schwere psychische Störungen erhöht ist.
Und wer seinem Alltagsrassismus nachgibt, hält das System aus Vorurteilen, Stereotypen und Diskriminierungen aufrecht. Aber wie kommen wir aus diesem System heraus?
Eine Welt voller Streit und Kampf
Die Journalistin Hadija Haruna-Oelker plädiert in ihrem Buch „Die Schönheit der Differenz: Miteinander anders denken“ für eine diverse Gesellschaft. Voneinander lernen und einander zuhören sollen wir, Gelerntes verlernen und miteinander anders denken.
Das liest sich wie eine Utopie aus schönen Phrasen. Haruna-Oelker schreibt aber auch, dass die Entwicklung nicht ohne Widerstände in der Mehrheitsgesellschaft stattfinden kann. „Es braucht eine zeitgemäße, ja auch progressive Haltung für eine plurale Gemeinschaft, die neu entstehen soll und akzeptiert, dass in einer offenen Gesellschaft Streit dazugehört und Disharmonie als Chance ansieht.“
Streit als Chance? Immerhin, so erklärt sie mir, würden jetzt viel mehr Menschen mit „am Tisch“ sitzen und seien Teil der Auseinandersetzung, auch wenn es dabei noch viel Ungleichgewicht gäbe, was die Deutungshoheit und Augenhöhe angeht. Damit meint Haruna-Oelker auch das schlechte Gewissen, das ich bei Menschen erzeuge, wenn sie mir sagen, ich sehe ja gar nicht nach Migrationshintergrund aus. Veränderung komme nicht von irgendwoher, sondern sei schon immer erstritten und erkämpft worden, sagt Haruna-Oelker. Sie zitiert den ehemaligen Bundespräsidenten Gustav Heinemann, der meinte, dass wir bereit sein müssen, „mit dem eigenen Unvermögen konfrontiert zu bleiben.“
Ich frage Haruna-Oelker wie der Streit denn aussehen soll, sodass wir uns nicht die ganze Zeit anschreien. „Wir leben in einer rationalen Gesellschaft. Eine, die der Rationalität die Neutralität zuschreibt und Emotionalität ausblendet. Dabei geht es in den meisten Debatten hochemotional zu, weil wir dabei über Gesellschaftsgeschichte und nicht verarbeitete Vergangenheiten sprechen und die betrifft uns alle.“
Statt uns also auf unseren störrischen Gehirnen auszuruhen und Vorurteilen nachzugeben, sollten wir uns zwei Dinge klarmachen. Erstens: Wir denken und handeln in Schubladen und Vorurteilen und reproduzieren damit auch Rassismen. Und zweitens: Wir sind dadurch nicht automatisch schlechte Menschen.
Unterschiede würden auch nicht einfach aufhören zu existieren. Wir seien eben unterschiedliche Menschen. „Daran ist nichts Schlechtes, sondern das wird es erst, wenn daran Abwertungen gekoppelt sind. Wir stehen in vielen Diskussionen zwar oft noch ganz am Anfang“, sagt Haruna-Oelker. Aber auch, dass es jetzt schon auch immer wieder Veränderungen zum Positiven in der Gesellschaft gebe.
Als ich 2015 meinen Rucksack zu mir gezogen hatte, habe ich mich lange geschämt und noch heute schüttelt es mich kurz, wenn ich daran denke. Haruna-Oelker beschreibt das, was ich empfinde, in ihrem Buch so: „Auch Menschen, die verletzen, erleben emotionale Zustände, wenn ihnen klar wird, dass sie etwas verschuldet haben, insbesondere dann, wenn es unabsichtlich geschehen ist.“ Deswegen neigen viele Menschen auch dazu, sehr defensiv zu reagieren, wenn sie mit ihren Vorurteilen konfrontiert werden. „Ich bin doch kein Rassist!“, sagen viele empört. Das ist nur verständlich, denn niemand möchte mit den Rechtsextremen verglichen werden, die durch Städte marschieren und rassistische Parolen rufen. Haruna-Oelker warnt aber auch: „Ein schlechtes Gewissen verunmöglicht Selbstreflexion. Deswegen empfehle ich Reflexion ohne Selbstgeißelung.“ Wir würden nunmal alle von Kindheit an von den rassistischen und diskriminierenden Strukturen geprägt werden, das ist nicht mehr zu ändern. Nun müssten wir eben lernen zu verlernen. Deshalb gelte es, das Gelernte zu verlernen. „Es geht mir um eine lebenslange lernbereite Haltung.“
Das Problem mit der Scham
Aber gehört das ständige Verletzen und Verletztsein wirklich zu einer Gesellschaft dazu? Ich rufe die Journalistin und Autorin Canan Topçu an. Sie hält nichts von Haruna-Oelkers Utopie. Im Frühjahr erschien ihr Buch „Nicht mein Antirassismus“. Darin stellt sie auch die Frage, „wo die Grenzen verlaufen zwischen Unbedarftheit, Unkenntnis, Vorurteilen und Rassismus“.
Topcu argumentiert in ihrem Buch, wer immer mit dem Kardinalvorwurf des Rassismus komme, beende Debatten eher, als sie zu fördern. Man rücke damit in gefährliche Nähe zu Denkverboten. „Ich kenne Leute, die sich einfach ausgeklinkt haben und überhaupt nicht mehr mit anderen ins Gespräch kommen, weil sie Angst haben, dass sie sich falsch verhalten“, sagt Topçu.
Konflikt sei ein Grundprinzip von Gesellschaft, erklärt mir Topçu. „Wir sollten lernen, mit Situationen und Menschen umzugehen, die man als fremd, beängstigend und unheimlich empfindet“, sagt sie weiter. Nur dann könnten wir unseren Umgang mit Ungleichheit reflektieren und es besser machen. Dazu gehöre aber auch das Bewusstsein über die eigenen Vorbehalte. Nur: „Was wir verlangen können, ist, dass die Leute sich nicht nach den Vorbehalten verhalten.“
Längst gehe es aber gar nicht mehr darum. Der Ton der Debatte sei wütend, aggressiv, spaltend. Nicht mehr Gleichbehandlung, sondern Deutungshoheit stehe dabei im Zentrum.
Canan Topçu sieht die Aufgabe nicht nur bei den Deutschen: „Beide Seiten haben da an sich zu arbeiten. Einmal die Menschen, die sich darüber aufregen, gefragt zu werden, wo sie herkommen. Und zum anderen alle, die fragen. Bei denen ist die Realität dieses Landes, vielfältig und bunt zu sein, noch nicht angekommen.“
So bleibst du einer von den „Guten“
In einer Migrationsgesellschaft zu leben, klingt schwieriger als es ist. Abseits der aufgeheizten Debatten über Sprech- und Denkverbote gibt es gute Nachrichten. Der Soziologe Aladin El-Mafaalani beschreibt das in seinem Buch „Wozu Rassismus? Von der Erfindung der Menschenrassen bis zum rassismuskritischen Widerstand“ so: „Dadurch, dass immer häufiger und lauter über Diskriminierung gesprochen wird, kann schnell der Eindruck entstehen, alles sei schlimmer geworden. Das Gegenteil ist der Fall: Früher haben Betroffene nichts gesagt, weil die Ungleichbehandlungen derart präsent und allgegenwärtig waren, dass sie kaum thematisiert werden konnten.“ Heute, so El-Mafaalani, seien wir viel stärker sensibilisiert und deswegen würden Diskriminierungen stärker auffallen.
Hätte ich also vor 40 Jahren in Deutschland gelebt, würde ich vermutlich noch viel mehr über meine Herkunft gefragt werden und gleichzeitig vollkommen selbstverständlich meine Tasche vor vermeintlichen Taschendieben beschützen. Weil sich die Gesellschaft aber verändert, nehme ich solche Situationen heute ganz anders wahr.
In einer Partnerschaft werden Probleme nicht kleiner, wenn man sie unter den Teppich kehrt. Im Gegenteil, die Verletzungen bleiben und häufen sich. So funktioniert auch Gesellschaft. Wir müssen uns der Wahrheit stellen, dass wir nicht vorurteilsfrei leben. Dass Vorurteile unseren Alltag prägen und wir lernen müssen, sie zu akzeptieren. Sie verschwinden nicht einfach, nur weil wir das wollen. Es wird zu Streit, zu Missverständnissen und auch zu einem diffusen Gefühl von Unwohlsein kommen. Vermutlich hätte es mir gut getan, im Bürgeramt von der Frau mit meinem Griff konfrontiert zu werden und so erstens die Gelegenheit zu bekommen, mein Verhalten zu reflektieren und mich zweitens zu entschuldigen.
Gleichzeitig werde ich weiter genervt auf Arabischer-Name-aber-blonde-Haare-Sprüche reagieren, vielleicht werde ich mich in einem unachtsamen Moment selbst von Vorurteilen leiten lassen. Dass solche Verletzungen aber auch heilen und wir daraus lernen können, kenne ich aus meinem eigenen Leben. Eigentlich ist es recht einfach: Wenn wir jemanden mit Worten oder Taten verletzen, dann bitten wir um Entschuldigung und versuchen, uns zu verändern. Ehrlich gesagt: Meine heute engsten Freunde haben mich auch mal gefragt, woher ich komme und dann meine blonden Haare kommentiert.
Redaktion: Thembi Wolf, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Philipp Sipos, Audioversion: Christian Melchert