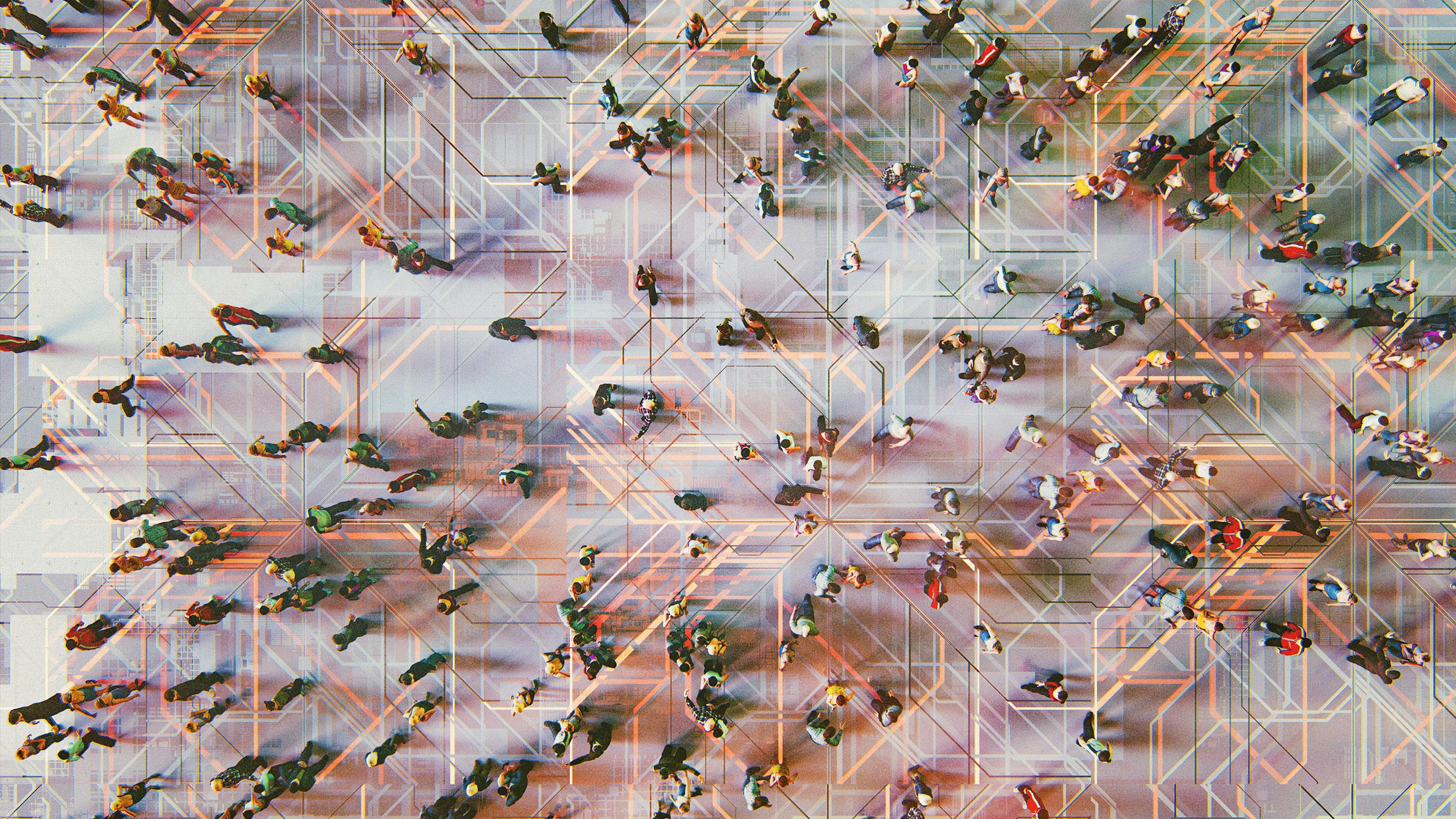Manchmal stellen Wissenschaftler:innen Fragen, auf die ich niemals kommen würde:
Kann der Freund meiner Freundin, dem ich noch nie begegnet bin, dafür sorgen, dass ich ein paar Kilo zulege?
Inwiefern gleicht soziales Lecken unter Rindern dem Umgang amerikanischer Politiker:innen untereinander?
Oder: Was haben Bewegungen auf Finanzmärkten mit sexuell übertragbaren Krankheiten gemeinsam?
Tatsache ist: Diese Fragen wurden gestellt. Und es gibt Antworten: Ja, es deutet einiges darauf hin, dass eine Person, die ich nie gesehen habe, mein Gewicht beeinflussen kann (dazu gleich mehr). Es gibt eine Studie, die zeigt, dass Lecken bei Rindern die gleiche Funktion erfüllt wie Netzwerken bei US-Senator:innen. Und der Epidemiologe Adam Kucharski verglich die ansteckende Wirkung von Finanzkrisen in seinem Buch „Das Gesetz der Ansteckung“ mit der Übertragung von Geschlechtskrankheiten.
Forscher:innen, die sich mit solchen Fragen beschäftigen, untersuchen Netzwerke. Sie wollen verstehen, wie sich Emotionen, Informationen und Verhaltensweisen unter Menschen verbreiten. Sie wissen: Wir mögen als Individuen handeln, aber wir tun es nie isoliert. Wir beeinflussen einander. Weil wir verbunden sind, selbst wenn wir uns nicht kennen.
Das weiß natürlich jede:r, theoretisch. Aber wie sehr sind wir wirklich miteinander verstrickt? Über welche Entfernungen beeinflussen uns Menschen, denen wir nie begegnet sind, und welche gravierende Bedeutung können Handlungen haben, die uns klein und persönlich vorkommen?
Ich habe mir diese Fragen selten gestellt, bevor ich diesen Artikel schrieb. Jetzt kann ich über nichts anderes mehr nachdenken.
In diesem Text geht es um die Netze, in denen wir hängen. Darum, wie sie uns helfen und schaden. Und ein bisschen geht es auch darum, wie wir uns schützen können.
Wenn Stress sich wie eine Krankheit ausbreitet
Nicholas Christakis arbeitete als Hospiz-Arzt in Chicago und besuchte todkranke Patient:innen in den Arbeitervierteln der Stadt. Das war um die Jahrtausendwende. Eine seiner Patientinnen war eine ältere Frau mit Demenz. Sie war todkrank, ihre Tochter pflegte sie. Die Tochter stand deshalb unter extremem Stress. Ihren Mann belastete das. Eine traurige Situation, aber nicht ungewöhnlich. Eines Abends aber bekam Christakis einen Anruf von einem Freund des Ehemanns. Der Mann bat um Rat. Die Situation seines Freundes nehme ihn mit, sagte er. Er litt darunter, obwohl er keine persönliche Verbindung zu der Sterbenden hatte.
Es war, dachte Christakis, als hätte der Stress sich wie eine Krankheit ausgebreitet: von der Tochter auf ihren Ehemann und anschließend auf dessen Freund. Das Gefühl, schien es, lief wie eine Welle durch das Netz der Verwandten der Sterbenden und deren Freunde hindurch. Christakis erinnerte das an den Witweneffekt, den er gerade erforscht hatte: das Phänomen, dass Partner:innen von Verstorbenen ein höheres Risiko haben, ebenfalls zu sterben – vermutlich, weil Trauer Stress bedeutet.
Vielleicht, dachte Christakis, breiteten sich solche Effekte viel weiter aus, als bisher angenommen, über unmittelbare Verwandte hinaus. „Ich begann, die Welt auf eine ganz neue Weise zu sehen. Ich war wie besessen. Besessen davon, was es bedeuten könnte, dass wir in diese sozialen Netzwerke eingebettet sind und wie sie unser Leben beeinflussen“, sagte er später.
Wenn Gefühle, Meinungen oder Verhaltensweisen von einem Menschen auf andere überspringen, sprechen Forscher:innen von „sozialer Ansteckung“. Im Jahr 2007 veröffentlichte Christakis mit seinem Kollegen James Fowler eine der aufsehenerregendsten Studien, die dazu je gemacht wurden, sie heißt: „The Spread of Obesity in a Large Social Network over 32 Years“ („Die Ausbreitung von Übergewicht in einem großen sozialen Netzwerk über einen Zeitraum von 32 Jahren“). Die Forscher hatten dafür medizinische Daten aus einer Langzeitstudie ausgewertet, der Framingham Heart Study. Auf Basis dieser Daten konnten sie ein Netzwerk von 12.067 Personen mit mehr als 50.000 Verbindungen über drei Generationen hinweg kartieren.
Die Studie wurde 2007 im „New England Journal of Medicine“ veröffentlicht. Sie war sehr einflussreich. In den zehn Jahren nach Erscheinen wurde sie tausende Male zitiert. Die Forscher schrieben, sie hätten herausgefunden, dass sich krankhaftes Übergewicht über „soziale Ansteckung“ verbreiten kann. Wenn jemand aus der Framingham-Studie klinisch übergewichtig wurde, war die Wahrscheinlichkeit, dass seine Freunde ebenfalls übergewichtig wurden, um 57 Prozent erhöht. Bei dem Freund eines Freundes dieser Person lag die Wahrscheinlichkeit, dick zu werden, um etwa 20 Prozent höher. Das galt auch, wenn sich das Gewicht des Freundes gar nicht veränderte.
Glück knubbelt sich
Wie Spinnennetze sehen die Netzwerke aus, die Christakis und Fowler für die Studie visualisierten. Sie bestehen aus zwei Elementen. Das erste Element sind Knoten, die miteinander verbunden sind, diese repräsentieren Menschen. Das zweite sind die Verknüpfungen, die die Knoten miteinander verbinden. Die Kombination von Knoten und Verbindungen bildet ein Netz. Knoten mit mehr Verbindungen zu anderen sind besonders einflussreich.
Jeder Kreis in diesem Netzwerk steht für eine Person im Datensatz. Dieser Teil des sozialen Netzes umfasst 2.200 Personen. Rot umrandete Kreise stehen für Frauen, blau umrandete Kreise für Männer. Die Größe der Kreise ist proportional zum Body-Mass-Index der Person. Die Innenfarbe der Kreise zeigt den Übergewichts-Status der Person an: Gelb steht für eine stark übergewichtige Person (Body-Mass-Index ≥30) und Grün für eine nicht fettleibige Person. Die Farben der Verbindungen zwischen den Knoten zeigen die Beziehung zwischen ihnen an: Lila steht für eine Freundschaft oder eine Ehe, Orange für eine familiäre Verbindung. Copyright © 2007, Massachusetts Medical Society
Christakis und Fowler wurden berühmt. Sie schrieben ein Buch über ihre Ergebnisse, es heißt „Connected“. Darin stehen Sätze wie: „Sie kennen ihn vielleicht nicht persönlich, aber der Kollege des Ehemanns Ihrer Freundin kann Sie dick machen.“ Und sie gaben Interviews und traten im Fernsehen auf.
Sie analysierten die Framingham-Daten weiter und fanden noch mehr Beispiele für ansteckendes Verhalten: Alkoholkonsum, Rauchen und Einsamkeit etwa. Aber auch Glück knubbelte und verbreitete sich in den Netzwerken.
Kritiker:innen wiesen darauf hin, dass rauchende, glückliche oder übergewichtige Menschen sich in Netzwerken knubbeln, weil wir uns tendenziell Gefährt:innen mit ähnlichen Eigenschaften suchen. Homophilie nennen das Sozialwissenschafter:innen. Außerdem ist nicht klar, in welchem Maße die Umgebung, in der wir leben, Einfluss auf unser empfundenes Glück oder unser Gewicht hat. Wenn ich zum Beispiel in einer Gegend wohne, in der es weit und breit nur Fast-Food-Restaurants gibt, liegt es nahe, dass meine Freund:innen und ich mehr an Gewicht zulegen als in einem Viertel mit veganen Bio-Bistros.
Selbst die schärfsten Kritiker:innen bestritten jedoch nicht, dass es soziale Ansteckung gibt. Sie kritisierten zwar die Beweisführung, nicht aber die Beobachtung.
In jedem Fall wirft die Studie ungemütliche Fragen auf, die bis heute ungeklärt sind: Wenn mein Netzwerk meine Meinungen und mein Verhalten unbewusst beeinflusst, wie viel freien Willen habe ich dann wirklich?
Finanzblasen, Tötungsdelikte, Trinkspiele: alles ansteckend
Christakis und Fowler glaubten, dass sich der Mensch in vielerlei Hinsicht wie ein Vogelschwarm oder ein Fischschwarm verhält – er ändert in der Masse plötzlich die Richtung. „Ein Raucher hat vielleicht genauso viel Kontrolle über das Aufhören wie ein Vogel, der einen Schwarm davon abhält, in eine bestimmte Richtung zu fliegen“, schreiben sie.
Adam Kucharski, Epidemiologe an der London School of Hygiene and Tropical Medicine, betrachtet in seinem Buch „Contagion“ verschiedene Formen von Ansteckungen, von Krankheitskeimen über Finanzkrisen bis zu gähnenden Menschen. In seinem Buch erklärt er, warum man soziale Ansteckung nicht so gut nachweisen kann wie etwa die Wirkung von Medikamenten. Dafür bräuchte man kontrollierte Studien. Das geht mit einem Phänomen wie dem Gähnen: Man kann Versuchspersonen in Laborexperimenten gähnen lassen und beobachten, ob sie andere damit anstecken (tatsächlich ist soziales Gähnen ansteckend, nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Tieren). Dabei können die Forscher:innen kontrollieren, was die Versuchspersonen sehen und Ablenkungen vermeiden, welche die Ergebnisse verfälschen könnten.
Außerhalb von Laboren ist so ein Nachweis allerdings schwierig. Würde man zum Beispiel untersuchen wollen, wie sich Rauchen unter Freund:innen verbreitet, müsste man zufällig Menschen auswählen, sie auffordern, sich das Rauchen anzugewöhnen und dann beobachten, wie der Freundeskreis reagiert. Das ist ethisch nicht vertretbar. Oder man müsste rauchende Menschen auffordern, sich zufällig neue Freunde und Bekanntschaften zu suchen, die nur aus Nichtraucher:innen bestehen. „Wer will denn schon für ein Forschungsprojekt sein gesamtes Freundschaftsnetzwerk durcheinanderwürfeln?“, fragt Kucharski.
„Epidemie“ ist ein griechisches Wort, das „im Volk“ bedeutet. Die alten Griechen meinten damit ursprünglich alles, was in einer Bevölkerung durchsickerte – vom Nebel über Gerüchte bis zum Bürgerkrieg. Seit der Antike wissen wir also, dass nicht nur Krankheitskeime ansteckend sind. Wir sprechen heute selbstverständlich über soziale Veränderungen als „Epidemie“, zum Beispiel die „Epidemie der Einsamkeit“, und von „viralen“ Posts.
Das ist nicht nur eine Metapher. Die Muster, nach denen Krankheiten sich verbreiten, sind für viele Gebiete außerhalb der Medizin wichtig. Erkenntnisse aus der Epidemiologie tragen dazu bei, Entwicklungen auf anderen Gebieten zu erforschen: Wie Finanzblasen entstehen etwa – nämlich entsprechend den vier Phasen einer Krankheitsepidemie: Auslöser (Spark), Wachstum (Growth), Maximum (Peak) und Rückgang (Decline). Oder wie sich Gerüchte und Falschinformationen verbreiten.
Der Epidemiologe Gary Slutkin erkannte, dass sich Tötungsdelikte in US-Städten nach ähnlichen Mustern ballen wie Cholerafälle in Bangladesch. Er entwickelte ein erfolgreiches Programm namens CeaseFire, das Gewalt wie eine ansteckende Krankheit behandelte. Und Adam Kucharski nutzte im Jahr 2014 sein Wissen über die Verbreitungsmuster von Krankheiten, um vorherzusagen, wie weit sich das Internet-Trinkspiel NekNomination verbreiten würde.
Einmal kräftig in Facebook niesen
Eine Trinkspiel-Prognose abzugeben, ist eine lustige Sache. Deutlich weniger witzig wird es, wenn Unternehmen oder Interessengruppen das Wissen über Ansteckungseffekte nutzen, um Menschen aktiv zu manipulieren.
In diesem Zusammenhang müssen wir natürlich über Facebook reden. Ein Team von Forscher:innen von Facebook und der Cornell University veränderte 2012 eine Woche lang die Newsfeeds von Nutzer:innen. Für einen Teil der Nutzer:innen entfernten sie Inhalte, die positive Wörter enthielten, für eine andere Gruppe Inhalte, die negative Wörter enthielten. Anschließend maßen sie, ob diese Eingriffe veränderten, was die Nutzer:innen posteten. Das war tatsächlich der Fall. Wenn man die Feeds negativer gestaltete, führte dies zu mehr negativen Posts und umgekehrt.
Die Stichprobengröße von 689.003 Personen war riesig – möglicherweise die größte in der Geschichte der Psychologie. Allerdings waren die gemessenen Auswirkungen in der Studie winzig und gehören zu den kleinsten statistisch signifikanten Ergebnissen, die jemals veröffentlicht wurden.
In sozialen Netzwerken können jedoch auch kleine Veränderungen eine große Wirkung haben – einfach, weil die Netzwerke so riesig sind. Manche Gefühle verbreiten sich zudem stärker als andere. Alles, was Überlebensinteressen weckt, Wut und Angst etwa, ist besonders ansteckend.
Michael Musalek hat das in der Pandemie beobachtet. Er ist Psychiater und leitet das Institut für Sozialästhetik und psychische Gesundheit in Berlin. Angst, sagt er, sei ein hoch infektiöses Gefühl. Aber auch aggressive Verhaltensweisen können sich kaskadenartig verstärken. Mithilfe des Internets verbreiteten sich diese Gefühle wie Krankheitserreger über Landesgrenzen hinweg.
Ein wütender Post in sozialen Medien kann also einen ähnlichen Effekt haben, als würde man einmal kräftig in eine riesige Gruppe von Menschen niesen.
Netzwerke machen uns politisch verwundbar
An dieser Stelle wird es düster. Dass Facebook und Forscher:innen die Feeds von User:innen emotional manipuliert haben, ist noch ein harmloses Beispiel. Nur wenige Jahre später hat der Fall Cambridge Analytica gezeigt, wie raffiniert sich Nutzer:innen sozialer Netzwerke beeinflussen lassen. Die britische IT-Firma hatte 2016 Daten von etwa 87 Millionen Facebook–Nutzern gesammelt, für psychologisches Profiling eingesetzt und damit unter anderem den US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump unterstützt.
Für Politiker:innen, Aktivist:innen und Unternehmen kann Netzwerkforschung sehr nützlich sein. Je mehr sie über die Struktur verschiedener Netzwerke wissen, desto besser können sie verstehen, wo die wichtigsten Knotenpunkte liegen – jene Stellen im Netz, an denen besonders viele Verbindungen zusammenlaufen oder von denen sich Informationen, Meinungen, Gefühle besonders schnell ausbreiten.
Die Möglichkeiten sind wie bei vielen Forschungszweigen zweischneidig, sagt der Kommunikations- und Netzwerkwissenschaftler Felix Victor Münch, der am Social Media Observatory des Hans-Bredow-Instituts forscht. Wie beispielsweise bei der Nukleartechnik, ist das Potenzial riesig. Sowohl im positiven Sinne, um etwa Informationen über Impfen oder Klimaschutz zu verbreiten, als auch im negativen, etwa um Wahlen zu manipulieren und Fake News massenhaft zu senden.
„Wenn man Zugriff auf genügend Daten hat, lassen sich Follower- und Freundesnetzwerke kartieren. Dann kann man sehen, wer die zentralsten Akteure in diesen Netzwerken sind. Das hängt nicht nur davon ab, wie viele Follower:innen eine bestimmte Person hat, sondern auch von anderen Faktoren – zum Beispiel, wo die Person in einem Netzwerk platziert ist, und wie viele andere Teile des Netzes sie (gut) erreichen kann“, sagt Münch.
Soziale Netzwerke tendieren zu Clustern. Das heißt: Menschen agieren mit anderen, die ihnen ähnlich sind, sie ballen sich um bestimmte Themen. Ein Diskurs verbreitet sich eher in einem einzelnen Cluster. „Wenn du es schaffst, dass in verschiedenen Clustern die gleichen Inhalte gleichzeitig genügend groß aufploppen, dann gehen die deutlich einfacher global viral“, sagt Münch.
Mit einem Forscherteam hat er unter anderem die deutschsprachige Twittersphäre kartiert. So sieht sie aus:
Sieht aus wie das farbenfrohe Werk eines Fünfjährigen – ist aber die grafische Darstellung der deutschen Twittersphäre. Quelle: Walking Through Twitter: Sampling a Language-Based Follow Network of Influential Twitter Accounts
Jeder Punkt ist ein Twitter-Account. Um das Netz darstellen zu können, ließen die Forscher einen sogenannten Crawler durch das Netzwerk laufen, ein Programm, das Daten abfragt. Mithilfe des Crawlers konnten sie nachvollziehen, welche Accounts einander folgten, welche davon die meisten Follower hatten und somit, wie sich Informationen in diesem Netzwerk zwischen den zentralsten Accounts verbreiten können.
Man kann es sich wie eine Landschaft mit Städten und Dörfern vorstellen: Wo die Straßen zwischen den Accounts besonders dicht sind, ist eine Twitter-Stadt.
Über die wichtigten Accounts und Schlagwörter in deren Tweets – „Bundesliga“ etwa, „AfD“ oder „Nintendo“ – konnten die Forscher dann Knotenpunkte im Netz thematisch interpretieren und die Verbindungen darstellen.
Je mehr Accounts in einer Gruppe sind, desto größer ist der Punkt:
Die deutschsprachige Twitter-Sphäre, nach Themen gruppiert. Je mehr Twitter-Accounts in einer Gruppe sind, desto größer ist der Punkt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass ein großer Punkt im Netzwerk wichtiger ist: Die Pro7-Gruppe etwa wirkt groß, liegt aber eher am Rand. Der Punkt der ARD-Gruppe liegt dafür zentraler im Netzwerk und hat mehr Verbindungen zu anderen Gruppen. Quelle: Walking Through Twitter: Sampling a Language-Based Follow Network of Influential Twitter Accounts
Die Grafik ist eine Annäherung, weil die Forscher nicht Zugriff auf sämtliche Daten hatten. Außerdem verändert sich das Netzwerk mit der Zeit. Aber Münch hat zuvor auch die australische Twittersphäre kartiert und dabei ähnliche Strukturen entdeckt. Das ist ein Hinweis darauf, dass sich bestimmte Strukturen auf Twitter wiederholen könnten. Eine Verbindungen der Politiksphäre mit der Youtube-und Gaming-Sphäre über die des Entertainment (und des Sports) etwa. Oder die Tatsache, dass rechte Accounts sich am äußeren Rand des Netzes ballen.
Münch glaubt, dass prominente Entertainer als Ziel von Falschinformationen und politischen Meinungen unterschätzt werden. Einerseits sind sie beeinflussbar, weil sie oft wenig Fachwissen für komplexe politische oder wissenschaftliche Themen haben. Andererseits erreichen sie viele Gruppen in einer Gesellschaft gleichzeitig. Sie haben außerdem eine parasoziale Beziehung zu ihrem Publikum, das heißt, die Menschen vertrauen den Prominenten und fühlen sich ihnen nahe, obwohl sie ihnen nie begegnet sind. Und die Entertainer:innen haben Sendungsbewusstsein. „Genau solche Leute würde ich zu beeinflussen versuchen, wenn ich Falschinformationen verbreiten wollen würde“, sagt Münch. Gerade forscht er zu den Mechanismen, die dahinter liegen, wenn Prominente Falschinformationen verbreiten.
Belege dafür, dass er Recht haben könnte, hat die Pandemie geliefert: Xavier Naidoo verbreitete Verschwörungserzählungen, Til Schweiger begann zu schwurbeln und für die Kampagne #allesdichtmachen zogen 50 deutschsprachige Schauspieler:innen über die Corona-Politik der deutschen Regierung und die Berichterstattung der Medien her.
Wie wir immun werden
Soziale Ansteckung ist als Phänomen dank des Internets viel mächtiger, als es früher war. Die gute Nachricht ist, dass wir uns mit Meinungen, Gefühlen und Informationen nicht ganz so leicht infizieren lassen wie mit Krankheiten. Um sich mit Masern anzustecken, reicht es, einer Person zu begegnen, die Masern hat. Aber selbst wenn ich einer Person direkt begegne, die mir ihre politische Meinung erzählt, heißt das noch nicht, dass ich die andere Meinung übernehme.
Forscher:innen unterscheiden zwischen einfacher und komplexer Ansteckung. Gerüchte verbreiten sich oft über einfache Ansteckung: Wenn ich Harry-Styles-Fan bin und ein Freund mir sagt, dass Styles bald heiratet, erzähle ich das wahrscheinlich direkt weiter. Komplexe Ansteckung muss einen Schwellenwert überschreiten. Es müssten also zum Beispiel mehrere meiner Freunde vegan werden oder sagen, dass Merkel in der Flüchtlingskrise Fehler gemacht hat, damit ich diese Haltung übernehme.
Außerdem kann man auch gegen Informationen und Meinungen immun sein. Wenn ich aus einem progressiven Elternhaus komme, bin ich weniger anfällig für konservative Botschaften. Wenn ich viel Fachwissen über Windkraft habe, werden mich falsche Fakten dazu kaum erreichen.
Aber niemand ist gegen alles immun. Umso wichtiger ist es zu wissen, wie wir uns nicht nur mit Viren anstecken können, sondern auch mit Meinungen, Informationen und Gefühlen.
Was Informationen und Meinungen betrifft, brauchen wir Gesetze, die Menschen und Gesellschaften schützen. Wir müssen uns dagegen wehren können, dass Interessengruppen die Schwachstellen ausnutzen, die Netzwerke mit sich bringen. Etwas Bewegung zeigt sich hier in Europa schon: Die EU-Kommission will Microtargeting bei politischer Online-Werbung strenger regulieren. Also verhindern oder zumindest einschränken, dass politische Parteien aus Daten in sozialen Netzwerken Persönlichkeitsprofile erstellen und Menschen dann gezielt mit Botschaften eindecken, die zu ihren Werten passen.
Wenn es um Gefühlsansteckung geht, haben wir wie bei Krankheitserregern zwei Möglichkeiten, sagt Musalek. Erstens: Abstand halten, also zum Beispiel aggressive Menschen meiden oder ein Gespräch beenden, wenn klar ist, dass die Emotionen aus dem Ruder laufen. Zweitens: Das eigene Immunsystem stärken. Musalek glaubt, dass Schönheit dafür das beste Mittel ist: „Auch in einer Krise ist es von größter Bedeutung, sich möglichst viel Schönes zu gönnen“, sagt er.
Redaktion: Esther Göbel, Bildredaktion: Philipp Sipos, Schlussredaktion: Susan Mücke, Audioversion: Iris Hochberger