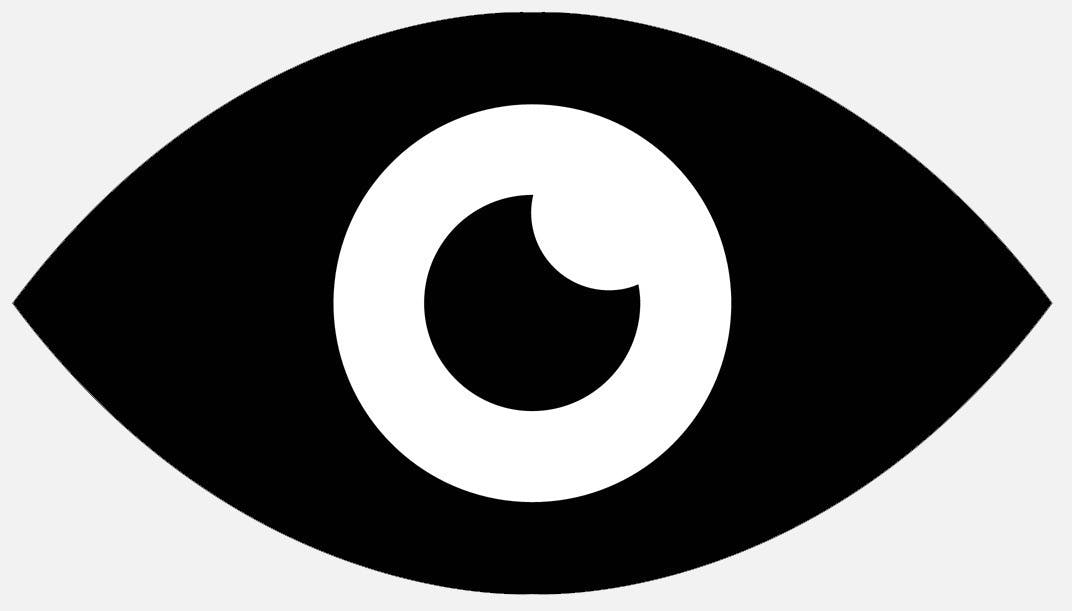Fünf Protokolle von Menschen, die ihre Laptop-Kameras abkleben, trafen einen Nerv. Unter meinem Artikel „Ja, wir haben abgeklebt! Das gar nicht mehr paranoide Verhalten von Menschen, die ihre Daten schützen wollen“ regten viele Krautreporter-Mitglieder eine tiefergehende Beschäftigung mit dem Thema an. Heute möchte ich die Frage beantworten: Hat die (Möglichkeit der) Überwachung soziologische und psychologische Auswirkungen?
Letztens hat mir mein E-Mail-Anbieter wie jedes Jahr am 1. Mai eine total nette Nachricht geschickt: „Lieber Horst, alles Gute zu deinem 62. Geburtstag! Wir haben hier ein besonderes Bonus-Geschenk für dich …“ Ich heiße weder Horst noch ist mein Geburtstag im Mai – und ich wohne auch nicht in der Geht-dich-nix-an-Straße. Aber ich habe damals genau diese Daten beim Erstellen meines E-Mail-Kontos angegeben.
So begann es. Ich wollte anonym bleiben. Damals habe ich meine Laptop-Kamera noch nicht abgeklebt, mittlerweile tue ich das. Manchmal scherzen Freunde: „Jule fühlt sich eben besonders wichtig!“ oder „Setz dir lieber einen Alu-Hut auf, der schützt besser gegen die Kamera!“ Aber ist dieses Verhalten wirklich paranoid? Sogar die Bundesregierung verschenkte Sticker für die Laptop-Kamera. Ich sehe immer häufiger Menschen um mich herum mit Aufklebern auf der Kamera, ich höre von verschlüsselten E-Mails oder Leuten, die bestimmte Dinge bar bezahlen, statt die EC-Karte zu nutzen.
Der Ex-Innenminister: Furcht vor dem Staat trägt „teilweise wahnhafte Züge“?
Bleiben wir bei dem Beispiel mit der Laptop-Kamera. Interessant an meinem Verhalten ist ja, wie inkonsequent es ist: Die Kameras an meinem Smartphone klebe ich nicht ab. Und was ist eigentlich mit den Laptop-Mikrofonen? Wenn mir jemand erzählt, dass er das Mikrofon aus seinem Laptop ausgebaut hat und nur noch im Bedarfsfall ein externes ansteckt, dann denke ich: Na, der übertreibt es aber.
Wo verläuft die Grenze? Was ist ein normales Schutzbedürfnis – wo kippt es in den Alu-Hut-Bereich? Die Kamera ist der Ort, an dem ein abstraktes Problem sich manifestiert: ein Auge, das mich anglotzt. Und sie ist einer der wenigen Punkte, an denen ich unkompliziert physisch eingreifen und mich widersetzen kann.
Gegen wen? Gegen private Dienste, aber auch gegen den Staat. Der frühere Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) sagte im vergangenen Jahr, die Furcht vor dem Staat trage “teilweise wahnhafte Züge“. Aber was ist daran wahnhaft, wenn Menschen keine Fotos von ihren Geschlechtsteilen in den Händen der Regierung wissen wollen?
- Wenn ich bei Google Streetview mein Haus unkenntlich mache – paranoid oder normal?
- Wenn ich die Straßenseite wechsle, weil eine Kamera an der Hauswand hängt – paranoid oder normal?
- Wenn man im Sexshop lieber bar bezahlt statt mit Karte – paranoid oder normal?
Wir haben alle unsere individuellen Schmerzgrenzen. Je nachdem, wie alt wir sind, in welchen gesellschaftlichen Gruppen wir uns bewegen, auch in welchem Land wir leben. Ein Kollege aus der Schweiz wies mich beispielsweise darauf hin, dass der Schweizer als solcher jedes Detail in Online-Formularen akkurat ausfülle – egal, ob obligatorisch oder nicht.
Der Soziologe: Nicht mit dem Smartphone in die Badewanne
Wie sehr Überwachung oder auch nur der Gedanke an Überwachung unser Verhalten beeinflussen, damit beschäftigt sich Stephan Humer im Fach Internetsoziologie an der Universität der Künste in Berlin. „Das Bestreben, Verhaltensänderung bei Überwachung zu beobachten, gibt es schon seit 1970ern“, sagt Humer. Schon damals wurde das untersucht mit Experimenten und Befragungen. Durch das Internet sind völlig neue Konstellationen möglich geworden, in denen wir überwacht werden können und entsprechend unser Verhalten anpassen.
Aber man kann sehr weit zurückgehen in der Forschungsgeschichte: Schon der französische Philosoph Michel Foucault beschäftigte sich mit den zunehmenden Überwachungs- und Kontrollmechanismen in der Gesellschaft des 18. und 19. Jahrhunderts und der sozialen Konformität von Individuen, die sich daraus ergab. Foucault nannte das „Panoptismus“ (vom griech. panoptes = „das alles Sehende“)
Soziologe Humer sagt: „Grundsätzlich ist es eine richtige Überlegung, dass wir unter Beobachtung Dinge nicht machen, die sozial nicht erwünscht sind. Aber es gibt Schwierigkeiten mit der Methodik, aus ethischen Gründen kann ich zum Beispiel kaum Menschen verdeckt beobachten und sie dann später damit konfrontieren. Zudem gibt es tausend Einflussfaktoren, die die Verhaltensanalyse erschweren. Es ist sehr schwierig, Szenarien zu basteln, die dann in Settings zu gießen. Ich kann den Leuten nicht in den Kopf gucken.“ Eine kleine Studie an der Universität von Newcastle zeigte, dass Menschen schon durch ein Bild von einem Augenpaar an der Wand in ihrem Verhalten beeinflusst werden: In den Wochen, in denen ein Augenpaar die Küchennutzer ansah, stieg die Summe in der Kaffeekasse.
Dass wir uns anders verhalten, wenn wir Überwachung einkalkulieren, daran besteht für den Soziologen Humer kein Zweifel. “Dass ich mir unter Beobachtung sage, dass ich jetzt besser nicht in der Nase bohre zum Beispiel, also dass es eine Form der Selbstregulation gibt, steht außer Frage.“ Aber das Maß sei unklar: Passen wir uns erst an, regen wir uns erst auf, wenn wir von der Überwachung erfahren? Das lässt sich schwer wissenschaftlich erfassen. „Und weil es die methodischen Schwierigkeiten gibt“, sagt Humer, „können sich Geheimdienste ja auch immer wieder darauf zurückziehen, dass die Überwachung im Hintergrund niemandem weh tut, dass die Leute erst jammern, wenn sie wissen, dass sie überwacht werden.“
Insgesamt, stellt Humer fest, sei das Bewusstsein der Überwachung in den letzten Jahren immer größer geworden. Es gebe bewusstere, konkretere Handlungen der Menschen. „Das wird an sehr vielen Stellen sichtbar, zum Beispiel wenn jemand sein Smartphone nicht mit ins Badezimmer nimmt, weil er die Handykamera nicht neben der Badewanne haben will“, sagt Humer, beanstandet jedoch: „All diese Dinge werden in Deutschland erst jetzt thematisiert, viel zu spät!“
Immer mehr Menschen wehren sich auf die eine oder andere Art. Doch bei vielen, so Humer, löse das Überwachungs-Gefühl auch eine gefährliche Alles-egal-Haltung aus: „Die Menschen stellen weniger eine Eins-zu-Eins-Beziehung zwischen sich und der Überwachung her, also zum Beispiel: Da hört einer am Telefon mit – deshalb verhalte ich mich konformistisch. Vielmehr entstehen Resignation und Fatalismus, gekoppelt an eine allgemeine Politikverdrossenheit nach dem Motto: Dann sag ich eben nix Wichtiges mehr am Telefon, sondern nur noch beim abendlichen Bier. Oder: Ich kann es eh nicht ändern, lasse ich es eben drauf ankommen, überwacht zu werden.“
Der Überwachungsgegner: Besser nicht „Erektionsstörung“ googeln?
Die Kamera-Augen am Laptop oder im öffentlichen Raum kann ich zumindest häufig noch sehen, sie treten dadurch in mein Bewusstsein. Doch was ist beispielsweise mit meiner Google-Suche? Wie oft denke ich darüber nach, dass möglicherweise irgendwann alles, was ich gesucht habe (jeder Schwarm, den ich je online gestalked habe; jedes Krankheitssymptom, über das ich jemals mehr erfahren wollte) gegen mich verwendet wird? In der Serie „New Girl“ gibt es den leicht verschrobenen Charakter Nick Miller. Eines seiner lustigsten Zitate lautet: „Ich bin ziemlich sicher, dass ich grad eine Herzattacke bekomme, und ich habe nicht geregelt, dass irgendjemand meine Internet-Such-Historie löscht: Ich habe keine Bombe gebaut! Ich war nur neugierig!”
Alex Marthews, der sich mit seiner Non-Profit-Organisation „Restore the fourth“ für mehr Datensicherheit einsetzt, hat gemeinsam mit der Forscherin Catherine Tucker vom Massachusetts Institute of Technology analysiert, ob Menschen nach den Snowden-Enthüllungen damit begonnen haben, Google anders zu nutzen. Nutzer aus den USA und zehn anderen Ländern, darunter auch Deutschland, nahmen an der Studie teil.
„Wir hatten erwartet, dass wir keinerlei Veränderungen im Verhalten von Menschen finden würden und dann halt erklären müssten, warum wir keine Veränderungen gefunden haben“, sagt Marthews. „Wir dachten, die politische Ignoranz der Menschen, die in vielen Studien nachgewiesen wurde, und dass sie sich nicht wirklich für die Nachrichten interessieren – dies würde sie davon abhalten, sich für Überwachung zu interessieren.“
Aber dann kam alles ganz anders, und die Forscher fanden heraus, dass Leute in den USA und auch außerhalb der Staaten nach bestimmten Begriffen weniger oft suchten. Sie googeln signifikant seltener Begriffe, die ihnen potenziell Ärger mit der Regierung einbringen könnten, zum Beispiel „Rohrbombe“ oder „Explosion“.
Doch Marthews und Tucker stellten noch andere Veränderungen fest: „Nicht nur Begriffe, die einen in Schwierigkeiten bringen könnten, wurden weniger gegoogelt“; sagt Marthews, „sondern auch persönlich sensitive Begriffe, die peinlich werden könnten - Depression, Abtreibung, Erektionsstörung, Anorexie zum Beispiel.“
Marthews schließt daraus, dass die Menschen ihr Verhalten ganz anders einschränken als nur in Bezug auf politische Inhalte. „Es scheint so, als würden die Menschen mit Überwachung durch den Staat oder bestimmte Unternehmen ähnlich umgehen, als würde ein Verwandter oder Freund die Suchergebnisse mitlesen. Also nicht so sehr ‘Big Brother’, sondern eher ‘Big Mother’, als würde dir deine Mutter über die Schulter schauen, während du bestimmte Dinge suchst.“
Welchem Menschen vertrauen wir so sehr, dass wir ihm unsere Google-Such-History zeigen würden?
Das Suchfenster ist ein Fenster, in das wir unmittelbar eintippen, was uns gerade bewegt, von Durchfall bis Liebeskummer. „Die Suchmaschine kann quasi deine Gedanken entstehen sehen, während du schreibst“, sagt Marthews. „Und ein Suchprotokoll über einen gewissen Zeitraum kann ein Bild deiner innersten Gedanken entwerfen.“
In den innersten Gedanken von Alex Marthews tauchen - würde man sein Suchprotokoll auswerten - verdammt häufig rosa Ponys auf: „Mein Computer wird von meiner siebenjährigen Tochter mitbenutzt. Deshalb enthält mein Suchprofil sehr viel ‘my little Pony’-Content“, sagt Marthews. Ihm gefällt die Idee, dass sein digitales Persönlichkeitsprofil durch dieses „Störfeuer“ unscharf gemacht wird.
Der Datenaktivist: Digitale Unschärfe erzeugen
Es gibt immer mehr Menschen, die diese Unschärfe ganz bewusst in größeren Aktionen erzeugen. So zum Beispiel das Bündnis „Akkurater Widerstand“ um den Berliner Michael Bukowski. Er und seine Mitstreiter rufen zu einem „Fake Data Day“ am 4. Juli auf, an dem Internet-Nutzer bewusst zum Beispiel bei Twitter ihren Wohnort ändern oder auf Facebook “Marschmusik” liken.
„Wir wollen nicht protestieren, nicht den Zeigefinger heben und sagen: Böse, böse! Wir wollen das Ganze spielerisch, positiv machen, ein digitaler Klingelstreich“, sagt Bukowski. „Wir möchten das Thema in den Mainstream bringen – zu Otto Normalverbraucher und Erika Mustermann.“
Auch Bukowski änderte erst nach und nach sein Verhalten, weil er sich durch Überwachung provoziert fühlte: „Als ich vor ein paar Jahren bei jemandem das erste Mal die Laptop-Kamera abgeklebt sah, da dachte ich auch: Was bist du denn für ein Alu-Hut?“ Mittlerweile klebt auch Bukowski seine Kamera ab. Und er nutzt noch andere Wege, um sich zu widersetzen: „Ich leiste spielerisch Widerstand, zahle zum Beispiel so viel wie möglich bar und freue mich dann diebisch, dass gerade kein Datensatz über mich generiert wird. Ich habe auch öfter mal mein Handy im Flugmodus, aber das kann man ja nicht immer machen. Das ist für mich quasi der kleine Widerstand zwischendurch.“
Bukowski sagt, die Snowden-Enthüllungen seien für ihn „der persönliche Zündfunke“ gewesen. „Bisher war ich bürgerrechtlich nicht besonders auffällig, jetzt wurde ich zwangsaktiviert.“
Für ihn sei die große Frage: „Wann tut es den Leuten weh? Bei vielen findet sich da eine Naivität, sich über Komfort im Alltag zu freuen, ohne dass man den Preis dafür bezahlt.“ Er hingegen empfinde beispielsweise ein „permanentes Unwohlsein“ aufgrund seines Wissens, „dass mein schickes neues Smartphone eine Universalwanze ist“.
Der Psychologe: Diffuse Ängste sind keine Paranoia
Gerald Mackenthun, Psychologe in Berlin, sagt, man müsse natürlich unbedingt unterscheiden zwischen dem Fachbegriff „paranoid“ und der umgangssprachlichen Verwendung: „Wenn sich Jungs auf dem Schulhof zurufen: Du bist ja schizo! Oder wenn Menschen über jemanden sagen: Der ist ja paranoid – solche Etiketten werden verwendet, um jemanden abzuwerten. Der andere hat einen Defekt, ich nicht.“
Paranoia sei ein durch Argumente nicht korrigierbarer Wahn, beispielsweise, dass man durch Strahlen manipuliert wird, dass hinter Wänden Kameras versteckt sind oder Mikrofone, dass man denkt, jemand sei hinter einem her. „Dabei geht es jedoch um undefinierte Mächte“, sagt Mackenthun, „nicht die NSA oder den KGB – das ist der Unterschied zum Normalbürger.“
Mackenthun würde jemanden, der zum Beispiel nur bar bezahlt oder die Laptop-Kamera abklebt, nie als paranoid bezeichnen. „Ich würde eher von diffusen Ängsten sprechen“, sagt der Psychologe. „Und Angst ist primär erstmal nichts Schlechtes, sie ist ein Warnsignal, auf das wir reagieren sollten – die Reaktion sollte der Angst angemessen sein.“
Menschen mit Paranoia erkenne man an einem ganz bestimmten Merkmal: „Sie wollen andere unbedingt von ihrer Sicht überzeugen, auf penetrante Art und Weise.“ Auch dieser missionarische Ansatz ist es also, der den Unterschied macht: Wer sich einfach nur schützen will – und mag es sein, dass andere ihn deshalb für verschroben halten – der ist noch lange nicht paranoid.
Der Psychotherapeut: Keiner weiß, was alles möglich ist
Der Psychotherapeut Ulfried Geuter hingegen meint, dass es schon ein wenig schwieriger werde, die Linie zwischen Paranoia und (berechtigten?) diffusen Ängsten zu ziehen: „Die NSA macht auch die psychotherapeutische Arbeit schwer“, sagt Geuter. Mancher Patient habe Angst vor Überwachung. Geuter erzählt von einem Patienten, der die Vorstellung hatte, die Therapie-Sitzungen würden abgehört. Das habe freilich paranoide Elemente. Andererseits habe der Patient nicht gewollt, dass man Informationen über ihn per E-Mail versende. Das wiederum sei spätestens seit den Enthüllungen von Glenn Greenwald einem berechtigten Schutzbedürfnis geschuldet.
Geuter fragt sich: „Wie kann ich einem Patienten, der dem elektronischen Versenden von Informationen über ihn misstraut, sagen, dass er mir vertrauen kann?“ Er selbst habe sich noch vor wenigen Jahren beispielsweise nicht vorstellen können, dass man ausgeschaltete Handys abhören kann. „Wenn mir jemand früher sowas erzählt hätte, dann hätte ich vielleicht scherzhaft gesagt: Na, du bist ja ein bisschen paranoid“, sagt Geuter. „Aber jetzt stellt sich heraus, dass es stimmt. Und das ist das Erschreckende.“
Niemand wisse, welche Möglichkeiten die Geheimdienste haben, und deshalb könne man immer schwerer eine klare Linie ziehen. „Wenn mir jemand sagt, dass er Ufos am Himmel gesehen hat, kann ich ziemlich sicher feststellen, dass das fern der Realität ist“, sagt Geuter. „Aber in vielen anderen Bereichen hat mittlerweile keiner mehr eine Ahnung davon, was alles möglich ist und was nicht der Wirklichkeit entspricht.“
Illustration: Min Kim