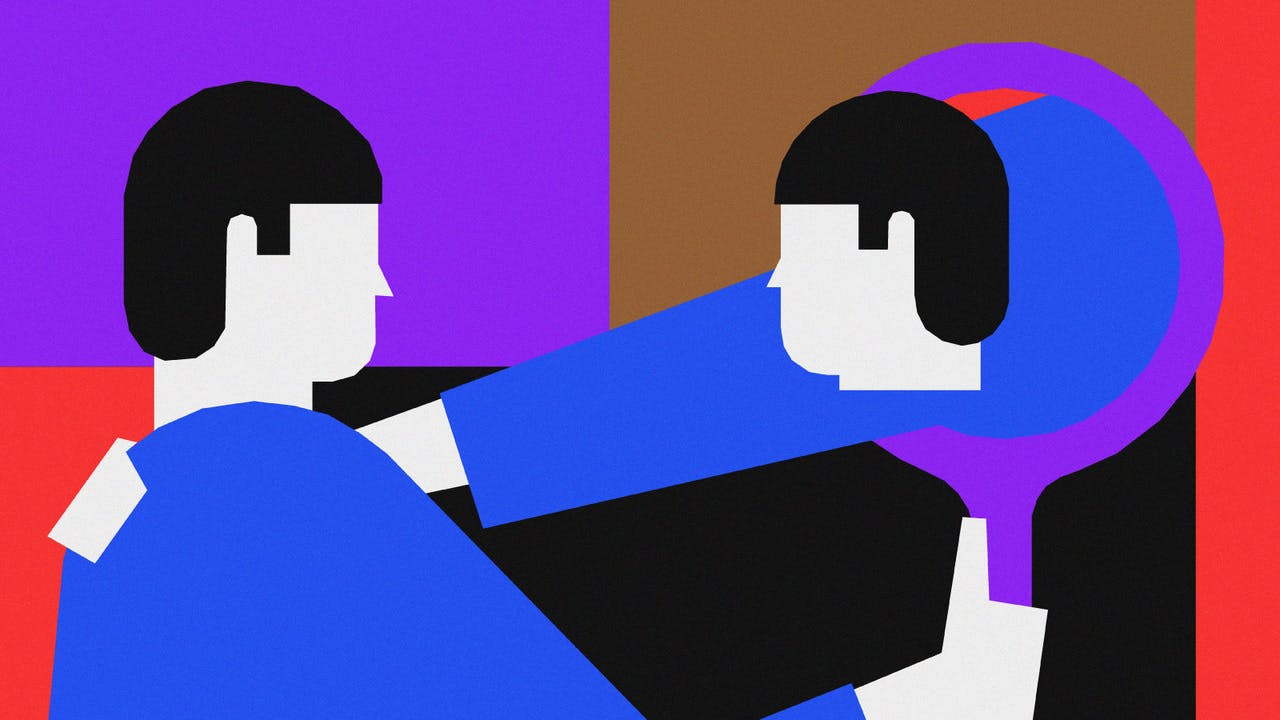Herr Schreiber, sind Sie einsam?
Jetzt gerade nicht. (lacht)
Und wenn Sie nachher zu Hause sind, allein?
Dann falle ich todmüde in mein Bett und frage mich, warum ich jemals Autor geworden bin! (lacht wieder)
Auch eine spannende Frage! Aber ich wollte ja mit Ihnen über das Thema Einsamkeit sprechen. Sie haben ein Buch darüber geschrieben, in dem es zentral um die Frage geht, ob man allein ein gutes und erfülltes Leben führen kann. Es ist ein schonungsloses Buch, denn Sie thematisieren darin auch Ihr eigenes Verlorensein. Warum?
Ich habe schon länger an dem Thema gearbeitet. Das Buch beschreibt unter anderem meine Einsamkeit während der Pandemie, aber ich habe insgesamt fünf Jahre daran geschrieben. Die pandemische Erfahrung hat das Thema für mich nur wie unter einer Lupe noch einmal vergrößert. Ich glaube, dass es wahnsinnig wichtig ist, über Dinge zu reden, über die wir als Gesellschaft nicht sprechen wollen. Fragen zu stellen, die man sich selbst nicht stellen mag und die wir uns auch als Kultur nicht trauen zu stellen. Denn hinter all dem Nichtreden verbirgt sich meiner Erfahrung nach häufig ein großer Schmerz.
Wieso fällt es so schwer, über Einsamkeit zu sprechen?
Es gibt mehrere Gründe dafür. Ein Hauptgrund ist die Scham, die mit dem Thema verbunden ist. Weil das Leben allein so gegen den Strich dessen läuft, wie wir leben sollten, wie wir uns ein gutes Leben vorstellen. Allein lebenden Menschen wird immer ein gewisses Scheitern konstatiert, ein defizitäres Leben. Die Lebensform, die unsere Gesellschaft uneingeschränkt befürwortet und als wirklich schützenswert empfindet, ist die als heterosexuell verstandene Kernfamilie. Alle anderen Lebensformen gelten leider als zweitrangig in unserer Kultur.
Warum ist das so?
Dahinter steckt die große Erzählung der romantischen Liebe, also diese Konstruktion von Liebes-und Familienglück, die ein sehr ernsthaftes Bedürfnis anspricht, das wir alle haben. Und zwar das Bedürfnis, nicht allein auf der Welt zu sein. Weswegen ich auch nicht glaube, dass sich an dieser Erzählung großartig etwas ändern wird.
Ihr Buch heißt „Allein“, aber es geht darin unter anderem um Einsamkeit – wie grenzen Sie den einen vom anderen Begriff ab?
Beide Begriffe umschreiben eine Bandbreite an Gefühlszuständen. Menschen beschreiben zum Beispiel das Gefühl des Nichtgesehenwerdens vom eigenen Partner als Einsamkeit oder auch das Gefühl, sich in Gruppen nicht verbunden zu fühlen. Ich persönlich versuche, diese Zustände deutlicher voneinander abzugrenzen. Allein leben oder allein sein heißt für mich, ohne eine romantische Beziehung zu leben, ohne eine Partnerschaft. Das heißt aber natürlich nicht, dass man ein Leben ohne Familie oder Freundschaften führt. Alleinsein kann man gestalten; ich verbringe zum Beispiel sehr gern Zeit mit mir allein. Einsamkeit hingegen lässt sich nicht gestalten.
Sie haben es angesprochen: Es gibt verschiedene Formen der Einsamkeit. Um welche geht es Ihnen ganz konkret?
Um wirklich akute Zustände der Einsamkeit. Wenn Menschen etwa sozial isoliert sind oder auch, wie in der Pandemie, räumlich voneinander isoliert sind. Und lange Zeit nur mit sich verbringen müssen, ohne große oder nennenswerte soziale Kontakte. Diese Art der Einsamkeit hat etwas Existentielles. Sie verändert unseren Blick auf die Welt, aber auch auf uns selbst.
Sie sprechen aus Erfahrung, denn Sie haben eine solche Phase durchgemacht. Wie lange dauerte sie bei Ihnen?
Ich würde sagen, sehr akut in der Pandemie von etwa März bis Juli 2020, also circa drei Monate. Und das war tatsächlich eine Riesenherausforderung. Ich habe in der Zeit kaum jemanden gesehen und hatte nur telefonisch oder virtuell Kontakt zu den Menschen, die ich am meisten liebe.
Dieser Text ist Teil einer Krautreporter-Themenwoche. Wir widmen uns einer Woche lang einem Gefühl: Einsamkeit. Warum wir das tun, kannst du hier nachlesen.
Wie sah Ihr Leben aus in diesen drei Monaten?
Durch die Pandemie fiel ein Großteil meines Einkommens weg, Lesungen etwa, Podiumsdiskussionen. Dadurch war ich gezwungen, noch mehr zu arbeiten als sonst, im Schnitt etwa zehn Stunden am Tag, sieben Tage die Woche. Ich habe versucht, wenigstens einmal am Tag rauszugehen, aber ich saß hauptsächlich in meiner Wohnung am Schreibtisch und arbeitete. Das war einerseits gut, denn so war ich wenigstens beschäftigt. Aber auch schlecht, weil dadurch die Organisation meines Soziallebens noch schwieriger wurde. Irgendwann stellte ich fest, dass ich in dieser Phase hypersensibel wurde für die Ablehnung oder Zuneigung von Menschen.
Können Sie das näher beschreiben?
Wenn zum Beispiel eine Freundin eine Verabredung zum Telefonieren absagte in jener Zeit, traf mich das mehr als sonst. Wenn ein Freund eine besonders nette Nachricht schrieb, war ich sehr berührt. Überhaupt geriet meine Kommunikation mit anderen Menschen ins Stocken. Ich war immer weniger imstande, meine Wohnung zu verlassen, sah Gefahren, wo es keine gab. Das war etwas, das ich so zuvor noch nicht erlebt hatte.
Was haben Sie gemacht in dieser Zeit, um durchzukommen?
Viel „Friends“ geschaut; durch die Fernsehserie hatte ich dann plötzlich virtuelle Freund:innen, die ich auch von früher schon kannte (lacht). Ich habe außerdem viel gestrickt und sämtliche Kleinkinder in meinem Freundes- und Bekanntenkreis mit Mützen und Strickjäckchen versorgt, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich beschreibe in meinem Buch aber noch andere Tätigkeiten, die man als Praktiken der Selbstreparatur verstehen kann: Gärtnern ist für mich wichtig, Wandern, Yoga. Das sind alles Tätigkeiten, die oft belächelt oder abgewertet werden. Sie sind aber wichtig, um mit sich selbst in Kontakt zu kommen und zu lernen, sich auszuhalten.
Sie schreiben in Ihrem Buch über Ihr Alleinsein: „Ich hatte das Gefühl, meine Situation selbst verursacht zu haben, gescheitert zu sein und all das zu verdienen.“ Haben Sie sich geschämt, als Sie einsam waren?
In jedem Fall, ja. Es gibt niemanden, der in solchen Phasen nicht denkt: „Ich bin selbst dran schuld. Ich habe etwas falsch gemacht. Warum habe ich keine besseren Beziehungen aufgebaut? Warum bin ich so schwer auszuhalten?“ Aber auch, wenn ich Ihnen das jetzt so sage und vieles mehr sogar in meinem Buch nachlesen kann, kann ich es nicht mehr richtig nachfühlen. Das ist ein weiterer Grund, warum es uns so schwerfällt, über Einsamkeit zu sprechen.
Wie meinen Sie das?
Neben der Scham gibt es eine psychologische Hürde, über die wir nicht wirklich springen können. Psycholog:innen wie Frieda Fromm-Reichmann oder Robert Weiss haben das schon vor langer Zeit erforscht, in den 1950er beziehungsweise 70er Jahren. Die Erfahrung existentieller Einsamkeit ist so traumatisch für uns, dass wir sie automatisch abspalten. Weil sie mit Schmerz einhergeht. Durch diese Abspaltung können wir nicht mehr empathisch auf das Gegenüber reagieren, das uns vielleicht gerade erzählt, er oder sie ist einsam.
Wir verlieren also die Anbindung an dieses Gefühl?
Ja, aber das ist noch nicht mal unbedingt eine Frage des Willens. Abspalten und verdrängen heißt: Etwas ist nicht mehr da. Wir haben also auf die Erfahrung keinen Zugriff mehr. Jede:r von uns hat Phasen der Einsamkeit gehabt – aber wenn sie vorbei sind, weiß man kaum mehr, wie diese Phasen sich angefühlt haben. Was man oft unterschätzt, ist, dass akute Formen von Einsamkeit mit einer psychologischen Entwicklung einhergehen, die dazu führt, dass man vollkommen den Bezug zu sich selbst verliert.
Das verstehe ich nicht; wenn man einsam ist, ist man doch die ganze Zeit mit sich selbst.
Man verbringt zwar viel Zeit mit sich, aber das heißt natürlich nicht, dass man sich notwendigerweise selbst spürt. Ein zentraler Punkt von Einsamkeit ist, dass man bestimmte Seiten von sich verliert. Nämlich die, die nur in Verbindung mit anderen Menschen und in sozialen Interaktionen existieren. Man merkt das vielleicht erst einmal gar nicht, aber das sind sehr bestimmende Seiten an uns.
Woher kommt diese Scham, von der wir gerade sprachen? Man könnte doch auch denken: „Klar habe ich mir eine Liebesbeziehung oder sogar eine Familie gewünscht. Aber das Leben ist eben anders gelaufen.”
In Phasen, in denen man nicht einsam ist und sich somit nicht in der psychischen Stresssituation befindet, die Einsamkeit mit sich bringt, weiß man das. Aber Scham hat wenig mit Bewusstsein zu tun. Und man vergisst auch, dass sie sich erst mit der Zeit einstellt. Das geht über Tage, Wochen, manchmal Monate.
Was mache ich in so einer Situation mit dem ganzen Schmerz? Wohin damit?
Daniel Schreiber © Christian Werner
Es gibt viele Möglichkeiten. Therapeutische Angebote anzunehmen, ist wichtig. Aber auch dann über die eigene Einsamkeit zu reden, wenn Menschen nicht darüber sprechen wollen, und es schwerfällt. Man sollte außerdem anfangen, die eigene Einsamkeit zu akzeptieren, sie sich einzugestehen. Und die Scham nicht vor sich selbst leugnen.
Ich frage mich gerade: Sprechen wir jetzt noch über Einsamkeit – oder waren Sie in der akuten Phase krank und litten an einer Depression?
Nein, ich kenne Depressionen gut, sie gehören zu meinem Leben. Einsamkeit ist etwas anderes. Sie kann oft als ein Inkubator für psychische Probleme wie Depression, Abhängigkeit oder Angststörungen dienen, aber es wäre falsch, sie damit gleichzusetzen. Was ich in Ihrer Frage höre, ist eher eine der Abspaltungs- und Vermeidungsstrategien, über die wir eben sprachen. Viele Menschen denken: Einsamkeit betrifft mich nicht, darunter leiden sowieso nur Menschen mit psychischen Störungen, in einem gewissen Alter oder gescheiterte Existenzen. Doch dem ist nicht so. Wie wir in den vergangenen anderthalb Jahren erlebt haben, können wir alle davon eingeholt werden.
Sie sagten, es sei wichtig, sich die eigene Einsamkeit einzugestehen. Wird es besser, wenn ich das tue?
Nein. Aber es ist ehrlicher, und diese Ehrlichkeit bereitet einen Boden dafür, dass sich vielleicht etwas verändern kann. Wenn wir uns so sehr für unsere Einsamkeit schämen, dass wir uns selbst erzählen, wir seien gar nicht einsam, wird sich auch mittel- und langfristig nichts daran ändern.
Haben Sie versucht, in der akuten Phase der Einsamkeit mit Freund:innen darüber zu sprechen, wie es Ihnen geht?
Ja. Aber ich habe auch gemerkt, dass vor allem meine engsten Freundinnen und Freunde extrem mit sich selbst beschäftigt waren. Wir mussten in dieser Zeit alle gigantische Herausforderungen bewältigen, und natürlich geht mit so einer Ausnahmesituation wie einer Pandemie einher, dass man sich auf die Bewältigung des eigenen Lebens konzentriert und gewissermaßen Nestinstinkte pflegt. Aber das war eine sehr bestimmende Erfahrung für mich.
Sie haben eingangs gesagt, dass Sie nicht daran glauben, dass sich die Erzählung der romantischen Liebe und des Familienglücks ändern wird. Aber was, wenn ich das nicht leben kann, aus welchen Gründen auch immer?
Keine Ahnung! (lacht)
Herr Schreiber, Sie müssen mir und den Leser:innen etwas Tröstendes sagen, ich bitte Sie! (lacht auch)
Viele von uns müssen mit bestimmten biographischen, psychologischen und ökonomischen Voraussetzungen ins Leben starten, die schwerer wiegen als bei anderen Menschen. Je nach Abstufung können diese Faktoren extreme Hindernisse darstellen. Das heißt aber nicht, dass man nicht für sich einen Weg finden kann, ein gutes und erfülltes Leben zu führen. Und es heißt auch nicht, dass man nicht für sich eine innere Arbeit leisten kann, die uns dabei hilft. Für alle queeren, migrantischen, armen Menschen oder Personen mit einer Behinderung oder besonders herausfordernden Biografien bedeutet das allerdings tatsächlich: Sie müssen eine andere innere Arbeit leisten als, sagen wir mal, der heterosexuelle, weiße, wohlhabende Durchschnittsmann.
Mussten Sie das auch, als schwuler Mann?
Ja, natürlich. Unter anderem habe ich elf Jahre lang Psychoanalyse gemacht. Ich sage das jetzt so leicht dahin, aber die Wahrheit ist: Das ist einfach eine grundsätzliche Begleiterscheinung von der Ungleichverteilung der Privilegien, die es in unserer Gesellschaft gibt.
Ist Einsamkeit eine Klassenfrage?
Nein, nicht nur, das geht über eine Frage nach sozialer Schicht hinaus. Es geht um die „richtige“ Hautfarbe, das „richtige“ Geschlecht, die „richtige“ sexuelle Orientierung, die „richtige“ soziale Herkunft, die „richtige“ geographische Abstammung, die „richtige“ psychologische Verfasstheit. Das alles sind Faktoren, die mitbestimmen, wie einsam wir uns fühlen. Menschen, die in diesen Faktoren benachteiligt sind, machen häufiger Einsamkeitserfahrungen. Das ist relativ gut erforscht.
Ich möchte noch auf einen anderen Punkt eingehen, der mir wichtig erscheint: Wenn Sie sagen, man sollte seine eigene Einsamkeit akzeptieren, heißt das im gleichen Atemzug, dass ich mich verabschieden sollte von bestimmten Sehnsüchten und Vorstellungen, das eigene Leben betreffend?
Ich glaube, für viele Menschen ist es das Allerschwerste, von Träumen, die man von sich und seinem Leben hat, Abschied zu nehmen. Gerade von solchen, die sich für die meisten Menschen zu erfüllen scheinen und deren Erfüllung man somit auch für das eigene Leben erwartet. Für mich waren das ganz konkrete Vorstellungen wie etwa die eines bestimmten Wohlstandes; ein Haus, ein Garten. Aber ganz realistisch betrachtet, ist das natürlich mit dem Beruf, den ich gewählt habe, nicht machbar. Oder die Vorstellung, einen Lebenspartner zu finden und eine Familie zu gründen.
Diese beiden Vorstellungen haben Sie wirklich ad acta gelegt, komplett?
Komplett lassen sich solche Vorstellungen und Sehnsüchte wahrscheinlich nie loslassen.
Also glauben Sie schon noch an die Liebe?
Ja, natürlich. Und ich würde für mich zum Beispiel nie sagen, dass ich für immer allein bleiben werde. Inzwischen finde ich das gar nicht unwahrscheinlich, aber niemand kann wissen, was in fünf oder zehn Jahren passiert. Doch das heißt eben nicht, dass ich diese Vorstellung als Grundlage für mein psychisches Wohlbefinden brauche oder für meine seelische Stabilität. Was mein Buch wirklich vermitteln soll: Wir können gut allein leben, auch wenn wir uns das nicht ausgesucht haben. Vielleicht ist es in mancher Hinsicht schwerer, aber es ist möglich und kann eine ganz eigene Schönheit entfalten, reich an Freundschaften sein, mit einem Gefühl der Freiheit einhergehen. Ich möchte das keineswegs idealisieren – ebensowenig wie ich das klassische Partnerschaftsmodell idealisieren möchte. Aber romantische Beziehungen sind nicht der einzige Weg, unser Bedürfnis nach Nähe und Aufgehobensein zu stillen.
Sie benutzen in Ihrem Buch den Begriff des Cruel Optimism, des grausamen Optimismus. Was genau verbirgt sich dahinter?
Die Idee stammt von der amerikanischen Philosophin Lauren Berlant. Sie beschreibt den Begriff so: Wir halten an Phantasien des guten Lebens fest, auch wenn wir in einer Gesellschaft leben, die die Erfüllung dieser Phantasien für viele von uns ganz konkret unmöglich macht. Und das sind eben Phantasien von Wohlstand und Liebesglück. Berlant pathologisiert dieses Festhalten aber gar nicht; für sie ist es eine adäquate Reaktion auf ein Leben, das sich für viele von uns wie ein Überlebenstraining anfühlt. Wir pflegen den grausamen Optimismus, weil wir sonst nicht weitermachen könnten.
Das klingt traurig.
Ja, aber ich glaube, dass das für viele Menschen eine Lebensrealität darstellt. Die Herausforderung besteht dann darin, Abschied zu nehmen von Vorstellungen, die uns unglücklich machen. Wenn uns zum Beispiel das Gefühl, keine Familie zu haben, unglücklich macht, oder das Wissen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein eigenes Haus mit Garten kaufen zu können, dann sollten wir diese Vorstellungen nicht als Maßstab für das eigene Gefühlsleben nehmen. Letztlich geht es immer um die Frage: Ist mein Leben gut genug? Und das ist eine sehr ernstgemeinte Frage. Unser Leben kann trotzdem schön sein, auch wenn bestimmte Phantasien nicht Wirklichkeit geworden sind und sich bestimmte Vorstellungen wahrscheinlich nicht mehr erfüllen werden. Wir können trotzdem dankbar sein für alles, was uns das Leben sonst geschenkt hat.
Freundinnen und Freunde sind etwas, für das Sie sehr dankbar sind. Aber gleichzeitig sprechen Sie sich in Ihrem Buch gegen die Überhöhung der Freundschaft aus; auch die sei kein Allheilmittel gegen die Einsamkeit, schreiben Sie.
Mir ist ein gewisser Abstand zum oft anzutreffenden, überzogenen Lob der Freundschaft wichtig. Dieser populär-kulturellen Idealisierung von Freundschaft sind wir in den vergangenen Jahren immer mehr begegnet: die beste Freundin, die uns in allem versteht. Der beste Freund, der immer für uns da ist. Diese Phantasie ist so schön, dass wir sehr gerne daran festhalten. Aber wenn wir auch nur halbwegs realistisch auf unsere Freundschaftsbeziehungen schauen, dann merken wir, dass das natürlich so nicht der Fall ist. Auch wenn ich meine Freunde und Freundinnen sehr liebe, haben wir häufig Konflikte, habe ich oft das Gefühl, ich werde nicht immer verstanden, sind sie nicht immer für mich da, und all das gilt natürlich auch in die andere Richtung. All das gehört aber zu Freundschaften dazu. Wenn wir die beschriebene Fiktion über unsere wirklichen Beziehungen zu unseren Freundinnen und Freunden legen, verpassen wir die eigentliche Begegnung mit diesen Menschen, mit ihrer Andersartigkeit, mit dem, was sie als Menschen ausmacht.
© Hanser Berlin
Ihrer Analyse nach sind wir alle dann im Grunde immer allein. Ist diese Andersartigkeit des anderen und – ich nenne es mal so – die Verständnislücke, von der Sie gerade sprachen, nicht auch eine Form von Einsamkeit?
Nein, das ist ein Riesengeschenk! Wir sollten uns wirklich klar darüber sein, dass wir das Gegenüber nie gänzlich verstehen können. Diese Vorstellung der Freundschaft als einer Beziehung von Gleichheit und Spiegelung, also zu glauben, dass der oder die andere genau dasselbe denkt, meint und fühlt wie ich selbst, ist letztlich eine narzisstische Fiktion.
Ich würde unser Gespräch gern mit einem Satz des Psychologen Clark Moustakas beenden, den Sie in Ihrem Buch zitieren: „Einsamkeit hat trotz Ihres Schreckens etwas zutiefst Positives.“ Was ist das Positive daran?
In Einsamkeitsphasen findet eine Selbstfindung statt. Wir lernen uns kennen, verstehen, wie sehr wir andere Menschen brauchen. Und wie bedeutend Liebe und Nähe in unserem Leben sind. Natürlich ist das ein schwacher Trost, wenn man sich gerade sehr einsam fühlt. Aber auch schmerzhafte Gefühle gehören zu unserem Leben, auch von ihnen lernen wir etwas. Einsamkeit ist letztlich immer auch eine notwendige Erfahrung. Ohne sie wären wir nicht die, die wir sind.
Redaktion: Lisa McMinn; Illustration: Sebastian König; Schlussredaktion: Susan Mücke, Audioversion: Christian Melchert und Iris Hochberger