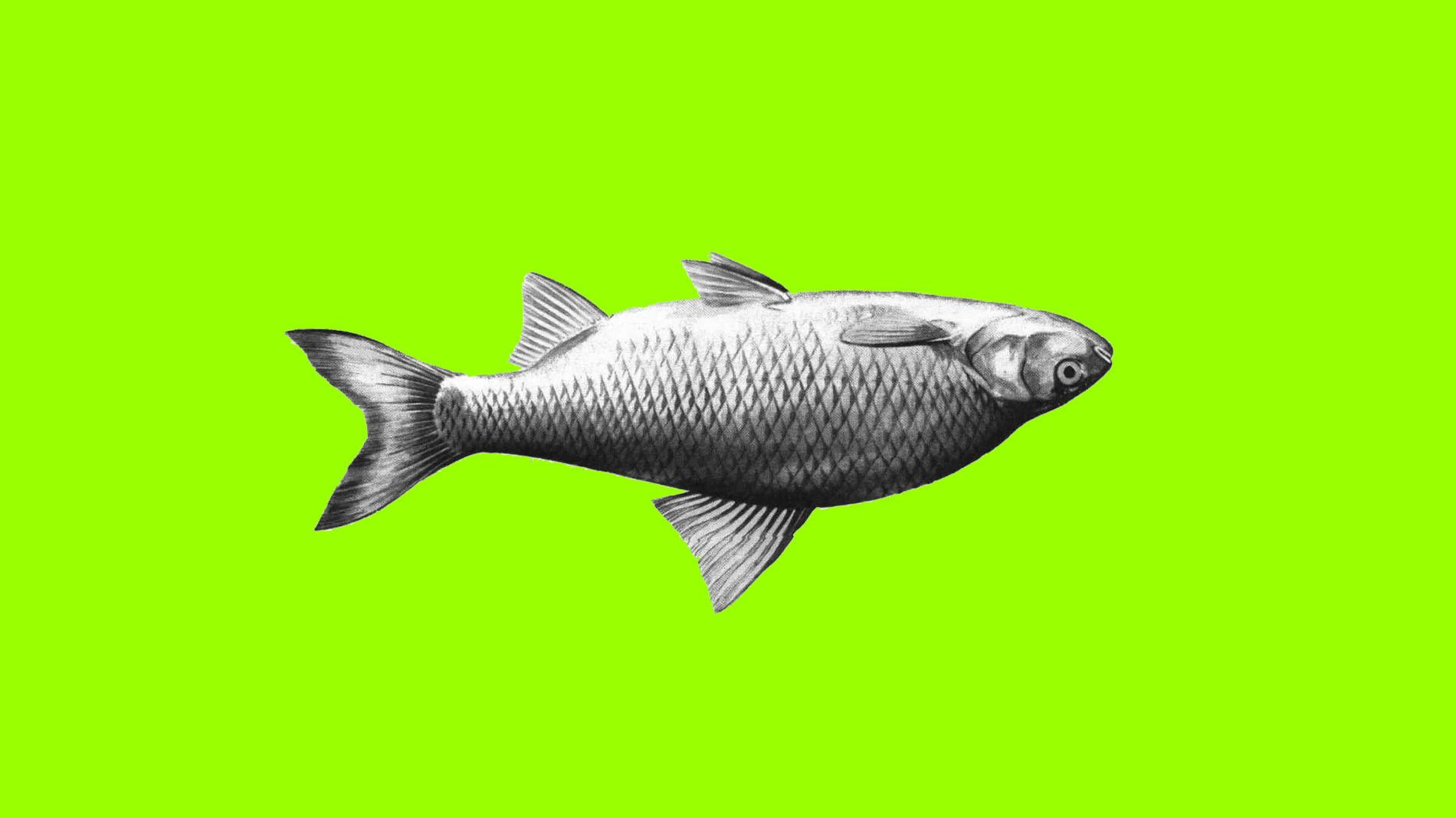Wenn es in Berlin regnet, sterben in der Spree die Fische. Denn der Regen flutet die Abwasserrinnen und Gullys und hebt den Wasserspiegel unter den Straßen. Er spült die Kanalisation aus und treibt das Abwasser der Millionenstadt Berlin ungeklärt in die Flüsse. Die Fische ersticken in dem, was wir im Klo herunterspülen. Sie treiben dann, so langsam wie die Spree fließt, mit den Bäuchen nach oben durch die deutsche Hauptstadt.
Wir trennen unseren Müll, gehen mit Jutebeuteln einkaufen und kutschieren unsere Kinder mit dem Lastenrad zur Kita. Doch unser Abwasser lassen wir oft noch ungeklärt in die Gewässer laufen. In Berlin passiert das beinahe wöchentlich, wie auch in vielen anderen europäischen Städten, die im Zuge der Industrialisierung im 19. Jahrhundert stark gewachsen sind.
In Spuckweite von der Spree entfernt, gleich hinter dem Roten Rathaus, sitzt Stephan Natz in einer kernsanierten alten Wäschefabrik und spricht über die „Mischwasserkanalisation“. Der Begriff geht ihm routiniert über die Lippen. Natz ist Sprecher der Berliner Wasserbetriebe (BWB). „Um 1860 war sie große Mode“, sagt er. Viele deutsche Städte, aber auch London, Wien oder Paris hatten eine. „Regen- und Abwasser teilen sich dort die Kanäle und fließen gemeinsam zur Kläranlage.“ Die Alternative sei das Trennsystem, das in Deutschland aber erst im 20. Jahrhundert populär geworden und in Außenbezirken und Neubaugebieten zu finden sei, sagt Natz.
An der Vauxhall Bridge in London ergießt sich der Kanalisations-Überlauf in die Themse Foto: Thames Tideway Tunnel Ltd.
Dieses Mischsystem hat einen großen Vorteil: Zur Abführung des Wassers wird nur ein Kanal benötigt. Problematisch wird es nur, wenn es plötzlich stark regnet. Die große Wassermenge überfordert das Fassungsvermögen der Kanäle und vor allem der Klärwerke. Die Bakterien, die dort für die Reinigung zuständig sind, benötigen für ihre Arbeit Zeit. Eine Überflutung der Klärbecken brächte sie völlig durcheinander. Das müssen die Wasserwerke verhindern - genauso wie ein Überlaufen der Kanäle auf Straßen und in Keller.
Die Lösung für dieses Dilemma wurde schon im 19. Jahrhundert bei der Anlage der Kanalisation mitgeliefert. „In den Kanälen gibt es eine Schwelle. Wenn diese überschritten wird, fließt das Wasser über einen sogenannten Regenüberlaufkanal in das nächste Gewässer“, erklärt Stephan Natz. Über 190 solcher Überlaufmöglichkeiten gibt es im Berliner Zentrum.
Als der Stadtbaumeister James Hobrecht 1871 die Pläne für die Berliner Kanalisation vorlegte, hatte die Stadt knapp 830.000 Einwohner. Heute sind es mehr als 3,5 Millionen, Tendenz steigend. Wegen des Klimawandels regnet es heftiger. Aus der Möglichkeit des Überlaufs ist eine Regelmäßigkeit geworden. Mittlerweile landen jedes Jahr über sieben Milliarden Liter Abwasser in Spree, Havel und den angeschlossenen Schifffahrtskanälen – und mit ihnen Fäkalien, Reifenabrieb von den Straßen oder Zink aus Dachrinnen. Akut führt das zu dem Sauerstoffmangel, der das Fischsterben verantwortet. Darüber hinaus sorgt es für eine starke Verkeimung und Algenwachstum.
Für einen trägen Fluss wie die Spree ist das besonders gravierend. Stephan Natz nennt sie einen „Flussdarsteller“: Im Sommer fließt das Wasser manchmal nur mit fünf Kubikmeter pro Sekunde; der Rhein kommt auf mehr als 1.000. Ein Tropfen Wasser braucht schon mal 14 Tage, um die Stadt zu durchqueren. Entsprechend lange bleibt der Dreck im Fluss, und der droht umzukippen.
Um gegen diese Verschmutzung der Gewässer vorzugehen, verabschiedete die EU im Jahr 2000 eine Wasserrahmenrichtlinie. „Wasser ist keine übliche Handelsware, sondern ein ererbtes Gut, das geschützt, verteidigt und entsprechend behandelt werden muss“, heißt es darin. Als Ziel wird formuliert, die europäischen Gewässer bis spätestens 2027 in einen guten Zustand zu versetzen. Dafür muss die Schadstoffkonzentration unter Schwellenwerte gedrückt werden, weshalb die Kanalisation nicht mehr so oft überlaufen darf. Vor dieser Aufgabe stehen seitdem alle europäischen Städte mit Mischwasserkanalisation.
Wie weit man bei der Einhaltung der Vorgaben schon ist, wie viele Maßnahmen umgesetzt werden und was das alles kostet, ist nicht einfach herauszufinden. Das sei Sache der Länder und Kommunen; eine bundesweite Liste werde nicht geführt, heißt es beim Umweltbundesamt.
In Berlin hat die Politik ein ganzes Paket an Maßnahmen zusammengestellt. „Das System bleibt, aber wir schaffen zwischen Kanal und Fluss einen Parkplatz auf Zeit“, sagt Natz. Unter der Erde werden dafür, verteilt über die Innenstadt, Speichermöglichkeiten geschaffen, in denen man bei Regen das zusätzliche Wasser zwischenlagern kann. Wenn es dann draußen wieder trocken ist, wird es von dort gesteuert zum Klärwerk gepumpt. Nach dem gleichen Prinzip wird derzeit deutschlandweit in die Verbesserung der Kanalisation investiert. Ob Bottrop, Erfurt oder Stuttgart, die Herausforderung ist überall die gleiche.
„Das Wasser muss da gespeichert werden, wo es anfällt“, sagt der BWB-Sprecher. Die Mischwasserkanalisation ist in Berlin in den stark verdichteten Altbauquartieren im Zentrum verbreitet, wo eh wenig Platz ist. Das macht das ganze Unterfangen zu einer besonderen Herausforderung. Große Stauräume vor der Stadt zu schaffen, sei keine Alternative, meint Natz. Zwar gebe es dort ausreichend Raum, doch das dafür benötigte Kanal- und Pumpsystem sei einfach zu teuer und koste zu viel Energie.
Große unterirdische Speicher sind eine Lösung, eine andere: das Wasser mit Wehren und Staumauern in der Kanalisation halten
Also muss in der Innenstadt Platz geschaffen werden. Zum Einsatz kommen dabei drei Varianten. Die erste sind unterirdische Beton-Becken, die aber nicht überall gebaut werden können, weil sie so groß sind. Eines mit 17.000 Kubikmeter Fassungsvermögen entsteht in direkter Nachbarschaft zum neuen Sitz des Bundesnachrichtendienstes. Unter der Erde „eine Kathedrale der Scheiße“, wie die taz titelte, darüber ein Spielplatz - denn überbaut werden darf eine derartige technische Anlage nicht. Viele Flächen bleiben unter dieser Bedingung nicht übrig.
Alternativ dazu kann das Wasser auch in extra angelegten Kanälen gestaut werden, die sich zum Beispiel unter Grünstreifen am Straßenrand unterbringen lassen. Das größte derartige Projekt in Berlin ist unter dem Mauerpark geplant. Bekannt ist die schmale Grünfläche entlang des früheren Mauerverlaufs für ein buntes Treiben irgendwo zwischen Grillfest und Musikfestival. Nun soll in acht Metern Tiefe ein 725 Meter langes Rohr mit fast vier Metern Durchmesser gegraben werden. „So ein Kanal ist günstiger und leichter zu warten als ein Becken – man muss nach dem Gebrauch nur einmal durchspülen“, sagt Natz.
Arbeiter bauen in einen bestehenden Kanal ein Wehr ein (Storkower Straße in Berlin) Foto: Berliner Wasserbetriebe
Noch einfacher ist es nur, vorhandene Kanäle als Zwischenspeicher zu nutzen. Das ist möglich, da die Kanäle ein weitverzweigtes Netz bilden und es in einer Stadt von der Größe Berlins nicht zwangsläufig überall regnet. Indem man in den Kanälen Wehre einbaut oder Staumauern erhöht, kann für eine begrenzte Zeit das Wasser auch innerhalb des bestehenden Systems gespeichert werden. Die große Kunst besteht darin, es so zu orchestrieren, dass das Wasser weder in die Flüsse noch aus dem Abfluss läuft.
Bis 2020 sollen in Berlin mehr als 300.000 Kubikmeter Speicherplatz geschaffen werden; knapp ein Drittel davon stehen noch aus. Allein dafür rechnen die Wasserbetriebe und das Land Berlin, die sich die Kosten teilen, mit Investitionen von 100 Millionen Euro.
Über solche Dimensionen kann man in London nur lachen. Anders als in Berlin, wo man auf hunderte kleine Maßnahmen setzt, favorisieren die Engländer eine große Lösung. Sie ist 25 Kilometer lang, hat einen Durchmesser von 7,2 Metern und soll in bis zu 65 Metern Tiefe unter der Themse verlegt werden. Im vergangenen Jahr wurde der Bau des Thames Tideway Tunnels beschlossen. 2016 sollen die Bauarbeiten starten, die sieben Jahre dauern und 4,2 Milliarden Pfund (5,8 Milliarden Euro) kosten sollen.
Die Londoner Kanalisation wurde in den 1860er Jahren angelegt. Damals lebten dort knapp drei Millionen Menschen. Der mit dem Bau betraute Ingenieur Sir Joseph Bazalgette zeigte sich vorausschauend und konstruierte die Kanäle für eine Einwohnerzahl von vier Millionen. Heute sind es noch einmal mehr als doppelt so viele.
London gibt sechs Milliarden Euro aus, um einen gigantischen Kanal unter der Themse zu bauen Karte: Thames Tideway Tunnel Ltd.
Das System ist mittlerweile so stark überlastet, dass es schon bei zwei Millimetern Niederschlag – und damit bei leichtem Regen – überläuft. Fast 40 Millionen Kubikmeter Wasser fließen so jedes Jahr ungeklärt in die Themse – fast sechsmal so viel wie in Berlin. Der riesige Stauraumkanal unter dem Fluss, der ein Fassungsvermögen von 1,6 Millionen Kubikmetern haben wird, soll diesen Wert drastisch senken: Statt wie bislang wöchentlich soll die Kanalisation nach Fertigstellung des Tunnels nur noch viermal im Jahr bei sehr starkem Regen überlaufen, hat das Wasserversorgungsunternehmen Thames Water errechnet. Die Kanalisation werde damit für die nächsten hundert Jahre und für das prognostizierte Bevölkerungswachstum der Stadt auf über zehn Millionen Einwohner fit gemacht, heißt es.
Ein Projekt dieser Größenordnung hat natürlich auch Kritiker. Sie klagen über die hohen Kosten und fürchten zudem massive Einschränkungen für Anwohner während der Bauarbeiten. Außerdem sei der Tunnel nicht nachhaltig gedacht, meint zum Beispiel die Gruppierung Clean Thames Now and Always, die sich in Opposition zu den Plänen der Wasserbetriebe gegründet hat. Statt die Folgen von Flächenversiegelung und Klimawandel, der es häufiger stark regnen lässt, unter der Themse zu verstecken, fordert sie, den Regen abzufangen, bevor er in der Kanalisation landet. Möglich machen sollen das durchlässige Straßenbeläge, die anders als klassischer Asphalt ein Versickern ermöglichen, sowie grüne, bepflanzte Dächer. Diese können nicht nur das Regenwasser speichern und dann durch Verdunstung langsam abgeben, sondern auch die Luft der Großstadt verbessern helfen.
Bei Thames Water hält man dagegen, dass derartige Maßnahmen angesichts der enormen Masse an Regenwasser einfach nicht ausreichten. Selbst wenn man die Hälfte der derzeit versiegelten Fläche aufrisse und Versickerung dort ermögliche, könne das Problem der überlaufenden Kanäle nicht beseitigt werden, argumentiert das Unternehmen, das seine Pläne ab dem kommenden Jahr verwirklichen wird.
Eine weitere Alternative zu den gängigen Speichermöglichkeiten ist im Berliner Osthafen zu besichtigen. Direkt angeschlossen an einen der Überlaufpunkte in die Spree liegt dort eine kleine, fest im Grund verankerte Insel aus Glasfaserrohren. 500 Kubikmeter aus der Kanalisation fließendes Mischwasser können in diesen Rohren zwischengelagert werden. „Spree 2011“ heißt das Pilotprojekt des Berliner Ingenieurs Ralf Steeg, das im März seine zweijährige Testphase erfolgreich abgeschlossen hat.
„Unterirdische Speicher, wie die Wasserbetriebe sie realisieren, sind immer Einzelanfertigungen“, sagt Steeg. Der Planungsvorlauf sei daher sehr lang; zudem sei es ein Fehler, die Speicher aus Beton zu bauen, der vom Abwasser zersetzt werde. „Was da geplant wird, ist zu teuer, dauert zu lange und hält nicht einmal“, meint er.
Gemeinsam mit der Technischen Universität Berlin und gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung hat er daher ein Baukastensystem aus Glasfaserrohren entwickelt, die sich flexibel zusammenstecken lassen, wobei die Rohre sowohl horizontal als auch vertikal verlaufen können und über- und unterirdisch sowie unter Wasser einsetzbar sind. Somit bieten sie zum Beispiel die Möglichkeit, künstliche Inseln anzulegen, diese zu begrünen und als Parkanlage am Wasser zu nutzen. Steeg träumt von einer kleinen Inselwelt in der Spree, die Gewässerschutz und Freizeitvergnügen vereinen. Doch die Stadt macht es ihm schwer.
Schwimmende Kloaken-Speicher: Testanlage im Berliner Osthafen Copyright: Luritec
Zwar sei der Anlage gerade erst von der TU bescheinigt worden, dass sie einwandfrei funktioniere und in den Betriebskosten günstiger sei als konventionelle Systeme, erzählt Steeg. „Wir bearbeiten nun mehrere Projekte in Deutschland und Vietnam.“ Doch in Berlin wird man mit dem Konzept, dessen Realisierung eine jahrelange Debatte vorausgegangen war, nicht warm.
„Spree 2011 ist Teil der Lösung, aber im Volumen viel zu klein“, meint Stephan Natz. Das Maßnahmenpaket der Wasserbetriebe sei geschnürt und durchgerechnet. Das werfe man jetzt nicht alles über den Haufen. Ob die Wasserbetriebe die Anlage kaufen und damit in den dauerhaften Betrieb übergehen lassen, ist offen; von Nachfolgeaufträgen ganz zu schweigen.
Gegenwind gibt es auch vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND): „Die von den Wasserbetrieben geplanten Maßnahmen erfüllen ihren Zweck. Weitere Tankanlagen wie im Osthafen verschandelten nur die Landschaft“, sagt der Referent für Gewässerpolitik, Winfried Lücking.
Statt über die Art der Speicher zu diskutieren, solle man sich besser darauf konzentrieren, dass auch nach dem Bau aller geplanten Speichermöglichkeiten in Berlin noch drei Millionen Kubikmeter Wasser pro Jahr ungefiltert in den Gewässern landeten. „Da muss noch mehr passieren“, fordert Lücking.
Auch für Stephan Natz von den Wasserbetrieben ist klar, dass es nach Beendigung des laufenden Programms 2020 weitergehen sollte. Für diese Entscheidung müsse jedoch noch das Land Berlin mit ins Boot geholt werden, das einen Teil der Kosten übernehmen müsse. Er sagt aber auch: „Es wird immer überlastete Kanäle geben. Es fehlt an Platz und Geld, um das Überlaufen vollständig abzustellen.“
Ralf Steeg will das nicht akzeptieren. Er träumt von einer Spree, in der nicht nur Fische, sondern auch Menschen schwimmen können. Jetzt baut er aber erst einmal in Vietnam.
Den Beitrag anhören:
https://soundcloud.com/krautreporter/juliane-wiedemeier-wenn-es-regnet-sterben-die-fische
Der Text wurde gelesen von Sofia Flesch Baldin von detektor.fm