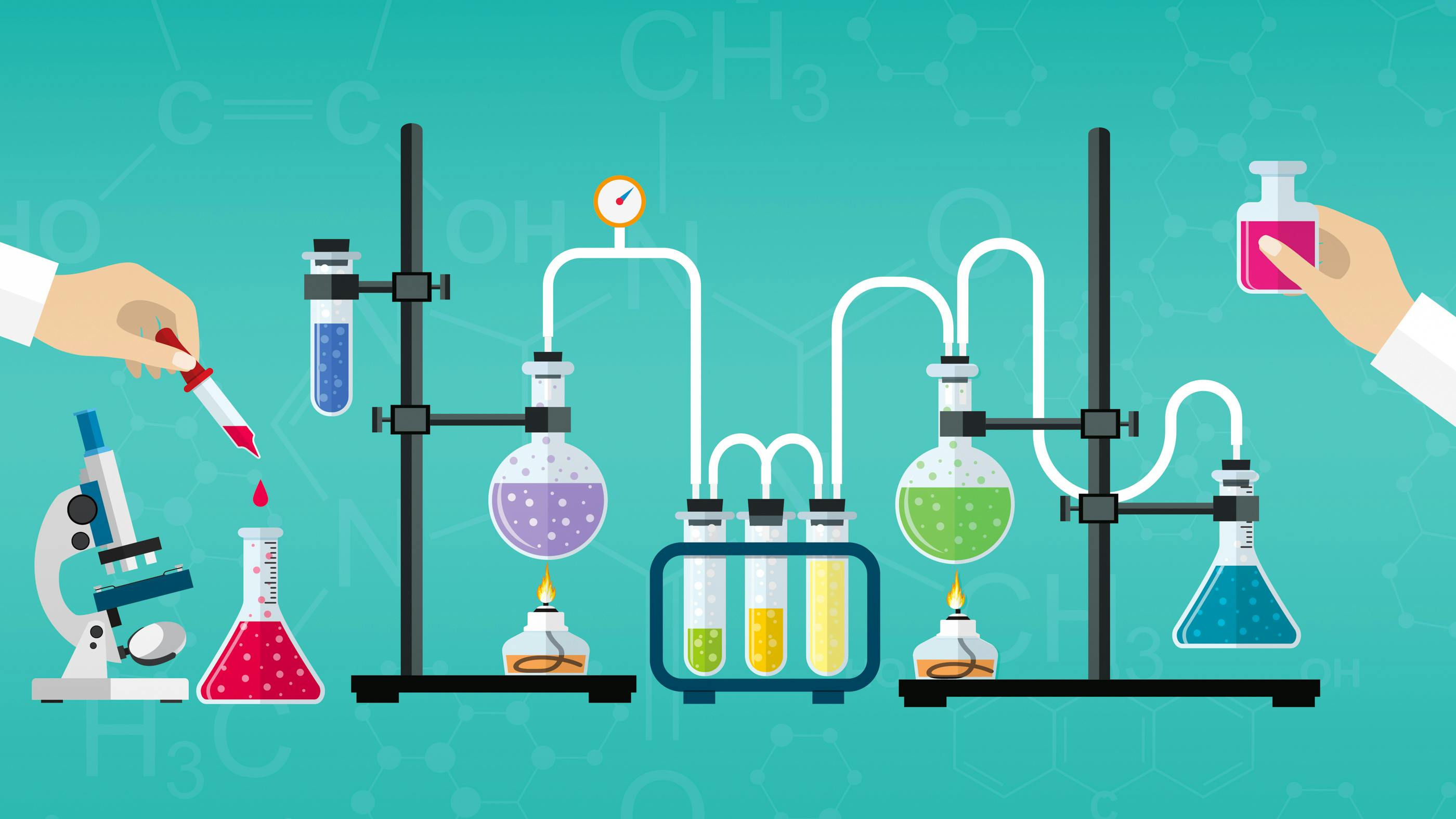Es gibt eine Macht, die alle Forscher:innen beeinflusst. Eine Macht, von der Menschen, die selbst nicht in der Wissenschaft arbeiten, nur wenig hören – die aber alle Wissenschaftler:innen kennen, hassen, selten lieben. Diese Macht lenkt einen Großteil ihrer Arbeit, entscheidet über Karrieresprünge, Forschungsgelder und darüber, was erforscht wird.
Nein, hier geht es nicht um Bill Gates oder irgendeine verschwörerische Sekte, die die Wissenschaft für ein teuflisches Projekt unterwandert hat. Es geht um Anerkennung. Oder wie Wissenschaftler:innen sagen: um Reputation. Sie ist die wichtigste Währung in den Laboren, Hörsälen und Rektorenbüros.
Die Reputation misst sich bei Wissenschaftler:innen an der Zahl ihrer Veröffentlichungen in angesehenen Forschungsjournalen. Forscher:innen, die in Magazinen wie „Nature“, „American Political Science Review“ oder „The New England Journal of Medicine“ veröffentlichen, gelten als hervorragend, als die Speerspitze ihres Feldes. „Publish or perish“, nennen Forscher:innen dieses Prinzip, also: Veröffentliche oder verrecke! Von dem Zwang, etwas zu veröffentlichen, profitieren vor allem die großen, wissenschaftlichen Verlage, die mit ihrem ausbeuterischen Geschäftsmodell eine höhere Gewinnspanne haben als Google und Facebook.
Die Corona-Krise aber hat dieses gewachsene, anscheinend unumstößliche System ins Rutschen gebracht. Anstatt monatelang darauf zu warten, dass irgendein Journal ihre Arbeit veröffentlicht, stellen Wissenschaftler:innen ihre Corona-Forschung einfach direkt ins Internet. Denn nur so kann die globale Forschergemeinde rechtzeitig einen Impfstoff finden oder die Virus-DNA entschlüsseln. Fortschritt findet plötzlich nicht mehr hinter den Bezahlschranken der Großverlage statt, sondern hier, in diesem Internet, zugänglich für jeden.
Was wie eine Kleinigkeit, vielleicht sogar wie eine Selbstverständlichkeit erscheint, hat das Potential, die Wissenschaft zu befreien. Es ist eine kleine Revolution, die sich gerade unbemerkt von der breiteren Öffentlichkeit abspielt.
Warum Corona die Wissenschaft verändern musste
Wenn du als Wissenschaftler:in eine wichtige Entdeckung machst, möchtest du sie auch deinen Kolleg:innen zeigen. Das dauert im Schnitt 117 Tage. So lange brauchen wissenschaftlichen Verlage, bis sie ein eingereichtes Manuskript in ihrem Magazin veröffentlichen. 117 Tage, die die Welt in der Corona-Pandemie nicht hat. Die Wissenschaft ist seit Corona vor allem eins: schneller.
Beispiel China: Schon am 5. Januar hatten Labore in China, darunter das von Zhang Yonhzhen, die DNA des neuen Coronavirus entschlüsselt. Das ist ein wichtiger Schritt gewesen, um das Virus besser zu verstehen – und vielleicht irgendwann einen Impfstoff zu bekommen. Aber Chinas oberste Gesundheitsbehörde, die Nationale Gesundheitskommission, hatte es den Laboren verboten, ohne Erlaubnis über das Virus zu berichten. Ein paar Tage später, am 11. Januar, stellte Zhang Yonhzhen den Code trotzdem ins Internet, ohne Erlaubnis und noch vor den Gesundheitsbehörden. Wissenschaftler:innen in Thailand, wo es zu einem der ersten Corona-Ausbrüche kam, hatten schon auf den Code gewartet. Sie fingen sofort an, die Sequenz zu analysieren.
Beispiel Deutschland: Wissenschaftler:innen der Universitäten Heidelberg, Freiburg, Tübingen und Ulm untersuchten zwischen dem 22. April und dem 15. Mai 2.500 Kinder auf eine aktuelle oder überstandene Corona-Infektion. Keine drei Wochen später wurden die Ergebnisse veröffentlicht. Eine solche Untersuchung hätte vor Corona Monate gedauert.
Viele Wissenschaftler:innen stellen ihre Ergebnisse jetzt einfach ins Internet, auf sogenannte Preprint-Server. Als Reaktion auf den Ebola-Ausbruch in Westafrika (2014 bis 2016) wurden 72 dieser sogenannten Preprints hochgeladen, beim Zika-Virus in Südamerika waren es 382. Und bei Corona? Eine Auswertung (erschienen ebenfalls als Preprint) zählt von Ende Dezember 2019 bis Ende April 2020 bereits mehr als 16.000 wissenschaftliche Artikel mit Covid-19-Bezug, davon sind mehr als 6.000 als Preprints erschienen.
Dabei handelt es sich nicht nur um medizinische und virologische Studien. Auch der sozialwissenschaftliche Preprint-Server SocArXiv meldet auf Twitter: Noch nie haben sie so viele neue Preprints veröffentlicht wie im Mai.
Veröffentlichen oder verrecken
Dass während der Krise so oft auf Preprint-Servern veröffentlicht wird, zeigt: Wenn es nur um Erkenntnisgewinn geht, ist die Wissenschaft nicht auf die großen Verlage angewiesen. So zu veröffentlichen, hat aber noch einen weiteren Vorteil neben der Schnelligkeit: Bisher werden (fast) nur positive Ergebnisse publiziert. Zu forschen kann aber auch heißen, jahrelang einer Frage nachzugehen und am Ende keine bahnbrechenden Ergebnisse zu erzielen. Das ist zwar traurig, ermüdend und frustrierend, kann aber auch eine wichtige Erkenntnis sein, sie taucht bisher nur in den Veröffentlichungen nirgends auf.
Der Zwang zur Veröffentlichung führt auch dazu, dass Forscher:innen nach sogenannten Low-hanging-fruits greifen. Um etwas zu veröffentlichen, beschäftigen sie sich lieber mit einem kleinen, nicht allzu schweren Problem, anstatt den großen, langfristigen Fragen nachzugehen, die mindestens genauso wichtig sind. Und sie spitzen ihre Forschungsfragen so zu, dass sie schon auf den ersten Blick interessant werden für die großen Magazine.
Wäre Captain Jack Sparrow ein Wissenschaftler, man könnte das derzeitige wissenschaftliche System mit einer Szene aus Fluch der Karibik zusammenfassen:
„Sie sind wirklich der schlechteste Wissenschaftler, von dem ich je gehört habe!“
Jack Sparrow: „Aaaaber sie haben von mir gehört!“
https://www.youtube.com/watch?v=-Yku2lH3fuY
Was Preprint-Server können
Dass Wissenschaftler:innen viel schneller auf Preprint-Servern veröffentlichen können als bei klassischen Verlagen, hat seinen Grund: Während Artikel, die in wissenschaftlichen Magazinen erscheinen, normalerweise vor der Veröffentlichung geprüft werden („Peer Review“), werden viele Preprints derzeit erst nach der Veröffentlichung von Kolleg:innen begutachtet, und zwar von allen, die wollen – die Studien sind ja für alle frei zugänglich.
Das aktuell vielleicht berühmteste Beispiel eines nicht-vorab-geprüften Artikels ist die Corona-Studie des Virologen Christian Drosten, in der er und sein Team herausfinden wollten, wie ansteckend Kinder sind. Nachdem er das Manuskript auf die Internetseite der Charité gestellt hatte, passierte, was passieren sollte: Wissenschaftler:innen auf der ganzen Welt haben es gelesen, die Schlussfolgerungen infrage gestellt, Statistiker:innen haben die Auswertung der Daten kritisiert. Eigentlich ziemlich optimal – dafür sind Preprint-Server da. Nur die Bild-Zeitung wollte daraus einen Skandal machen, sie titelte:
Preprint-Studien durchlaufen einen Schnellcheck: Ist das überhaupt ein wissenschaftlicher Artikel? Ist der Artikel so strukturiert, wie es normalerweise bei Manuskripten der Fall ist? Könnten Patient:innen die Studie lesen und sich dann in Lebensgefahr begeben, weil sie zum Beispiel eine riskante Therapie ausprobieren?
Die üblichen Peer-Reviews gehen da deutlich weiter. Die Gutachter:innen, die die Studie gegenlesen, fragen: Lässt sich die Forschungsfrage überhaupt mit diesen Methoden beantworten? Gibt es offensichtliche Fehler oder sogar Widersprüche? Kann ich die Ergebnisse wirklich so interpretieren, wie die Autor:innen es tun? Wenn dabei Fragen auftauchen oder sie Fehler entdecken, können die Gutachter:innen fordern, dass das Manuskript noch einmal überarbeitet wird.
Peer-Reviews sind keine Garantie für Qualität
Das Veröffentlichen bei großen Verlagen mit Peer-Review ist allerdings keine Garantie für Qualität. Am 9. März veröffentlichte zum Beispiel die South China Morning Post, eine englischsprachige Zeitung in Hongkong, einen Artikel über Forschungsarbeiten, über die das wissenschaftliche Magazin „Practical Preventive Medicine“ berichtet hatte. Das Magazin lässt all seine Artikel durch ein Peer-Review überprüfen. Die Überschrift zum Artikel: „Coronavirus kann doppelt so weit reisen wie der offizielle Sicherheitsabstand.“
Verheerend, oder? Müssten wir den Sicherheitsabstand also doch erhöhen? Auf drei Meter? Oder mehr? Dieser Artikel wurde mehr als 53.000-mal über Soziale Medien verbreitet.
Die Studie wurde nur einen Tag nach der Veröffentlichung des Zeitungsartikels zurückgezogen. Die Zeitung berichtete sofort über die Rücknahme, die Korrektur wurde aber weniger als 1.000-mal geteilt. Ähnliche Fälle gab es in den vergangenen Wochen auch bei dem renommierten Fachmagazin The Lancet.
Die Gutachter:innen beim Peer-Review können nicht alle Fehler entdecken. Sie können die Experimente nicht einfach selbst durchführen, um sie zu testen. Meistens werden auch keine Rohdaten mitgeliefert. In einem Bericht über die Qualität von Peer-Reviews schreiben die Autor:innen um Wissenschaftler Jonathan Tennant sogar: „Studien haben gezeigt, dass Peer-Reviews anfällig sind für Voreingenommenheit und Missbrauch, sie sind häufig unzuverlässig und können selbst betrügerische Forschung nicht aufdecken.“
Das ganze wissenschaftliche System muss sich verändern
Über die Qualität von Preprints kann man also streiten, über die von Peer-Reviews allerdings auch. Dass derzeit viel mehr Preprints veröffentlicht werden als üblich, beweist auch nicht, dass Peer-Reviews wertlos sind und abgeschafft werden können. Die Kontrolle durch unabhängige Wissenschaftler:innen bleibt enorm wichtig. Die Krise zeigt auch nicht, dass die Verlage völlig überflüssig sind. Das war auch nie das Ziel von Preprint-Servern. Die Krise zeigt aber: Wenn es wirklich darauf ankommt, ist Fortschritt wichtiger als Reputation.
Aber kommt es nicht immer darauf an? Sollte Fortschritt nicht immer über Reputation stehen?
Die Abkehr vom Prinzip „Veröffentliche oder verrecke!“, die wir gerade bei einigen Wissenschaftler:innen sehen, ist ein erster Schritt in diese Richtung. Und könnte auch andere Forscher:innen inspirieren. Ein weiterer Schritt ist es, Alternativen zu den großen Verlagen zu finden. Denn Verlage interessieren sich nicht für Innovationen oder Veränderungen, sie verdienen mit dem aktuellen System zu viel Geld. Der Drang, wissenschaftliche Ergebnisse schneller zu veröffentlichen, ist auch bei ihnen angekommen. Auch sie veröffentlichen Studien zu Covid-19 deutlich schneller. Auch erlauben es einige Verlage mittlerweile, die Studien vor der Veröffentlichung als Preprint ins Internet zu stellen.
Das reicht aber nicht. Es braucht auch neue Kriterien, um wissenschaftliche Qualität zu messen. Ellen Euler, Professorin für Open Access an der Fachhochschule Potsdam, hat mir gesagt: „Es gibt schon Hochschulen, die bei neuen Stellen sagen: Wir wollen gar nicht wissen, wie viel du wo veröffentlicht hast. Sag uns mal, wie du in deinem Fachgebiet Einfluss genommen hast oder welche Veränderungen du herbeigeführt hast. Das kann ganz unterschiedlich sein: ein Youtube-Channel oder sogar Interviews in größeren Zeitungen, die der Wissenschaft auch einen großen Dienst erweisen.“
Die Wissenschaftler:innen können sich ein Beispiel am Physiker Albert Einstein nehmen. Als er geforscht hat, vor 100 Jahren, wurden 100-mal weniger wissenschaftliche Artikel veröffentlicht als heute. Und so schlecht ist seine Reputation nicht.
Die Recherche hinter diesem Artikel:
Eigentlich sollte dieser Artikel ganz anders werden. Er sollte auch eine andere Überschrift tragen: „Wissenschaft, einfach erklärt“. Denn in den vergangenen Monaten hat sich gezeigt, dass das Zusammenspiel zwischen Öffentlichkeit und Wissenschaftler:innen nicht immer ganz glattläuft. Was auch daran liegt, dass viele Nicht-Wissenschaftler:innen nur einen kleinen Teil über die Arbeit in der Forschung wissen. So auch ich. Deshalb wollten wir den ganz großen Aufschlag wagen.
Wie bei Krautreporter üblich, habe ich unsere Mitglieder in einer Umfrage gefragt, welche Fragen sie zu diesem Thema haben. Nur: Es kamen viel weniger Antworten als üblich. Also habe ich in der Krautreporter-Facebookgruppe gefragt, woran das liegt. Die Antwort: Das Thema ist viel zu groß! Was soll man da fragen? Alles und nichts.
Unser Mitglieder hatten recht. Also habe ich meine Recherche auf das konzentriert, was sich gerade durch Corona in der Wissenschaft verändert. Mit 15 Mitgliedern hatte ich zu dieser Frage E-Mail-Kontakt, teils sehr ausführlich (Danke an Roman an dieser Stelle! Du hast mir sehr geholfen!). Auch das Gespräch mit Ellen Euler ging viel länger, als es das eine Zitat am Ende des Artikel erahnen lässt. Über anderthalb Stunden haben wir telefoniert. Erst das Gespräch mit ihr hat mich an das eigentliche Problem der Wissenschaft erinnert, das gerade jetzt so offenbar wird.
Redaktion: Rico Grimm, Schlussredaktion: Susan Mücke, Fotoredaktion: Martin Gommel