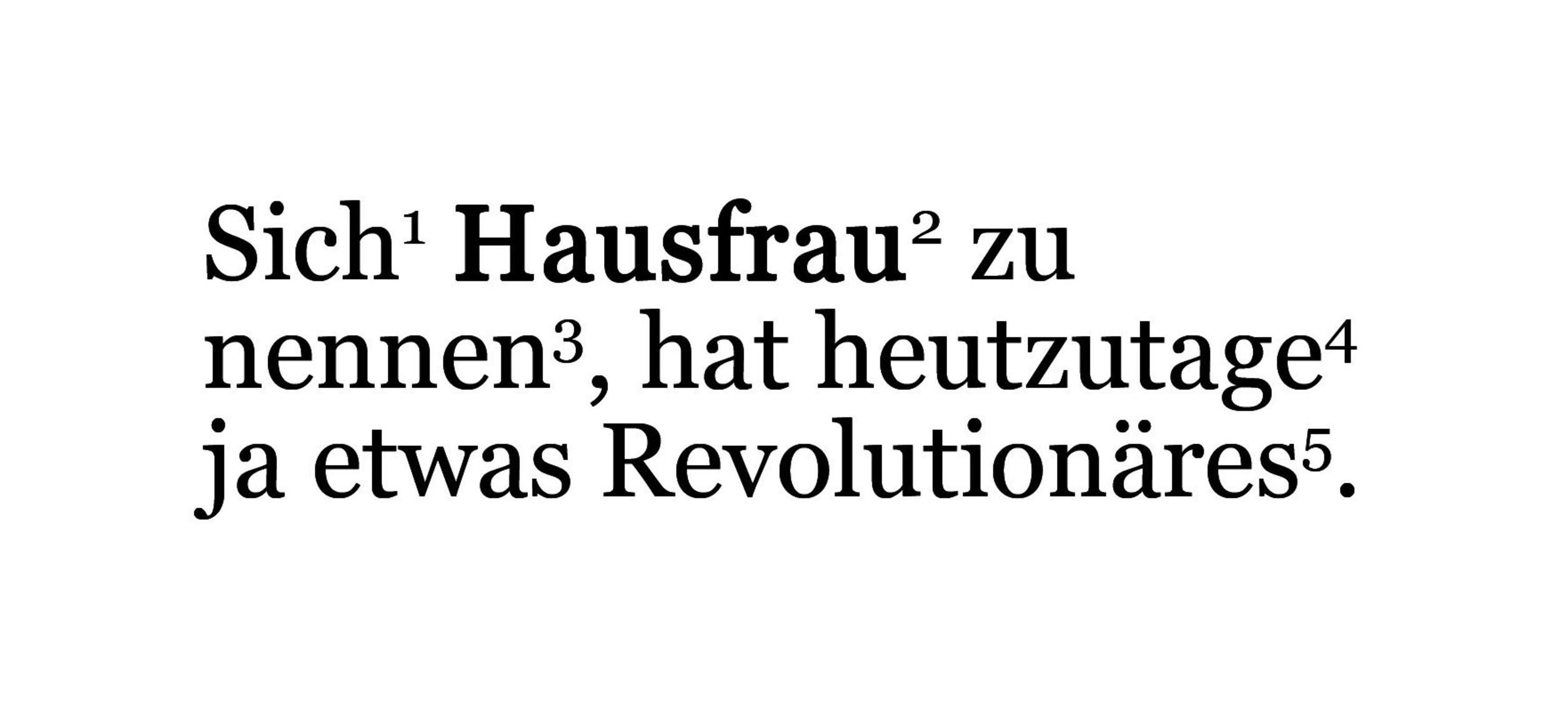1. Alina Bronsky hat sich irgendwann mal als „schreibende Hausfrau” bezeichnet, weil sie keine Lust hatte, sich „Bestsellerautorin” zu nennen. Typisch Frau, das eigene Licht so unter den Scheffel zu stellen? Vielleicht. Sicher ist es schwierig, sich eine weniger glamouröse Bezeichnung als „schreibende Hausfrau” vorzustellen. Vor seinem inneren Auge sieht man ein Wesen mit Kittelschürze und Augenschatten (das Kind hat die halbe Nacht gebrüllt) am Küchentisch sitzen. Sicher müsste sie auch dringend mal wieder zum Friseur. Und was schreibt sie da? Doch bestimmt keinen großen Roman, sondern eher eine Einkaufsliste … Man könnte es aber auch einfach sympathisch finden, dass hier jemand keine Angst davor hat, sich einen denkbar uncoolen Titel zu geben. Den Bronsky sich natürlich locker leisten kann, weil sie Bestseller schreibt. Wahrscheinlich sogar ohne Kittelschürze.
2. Hier wird es aber schon wieder schwierig. Was ist eigentlich eine Hausfrau? Dieser Begriff muss dringend einmal geklärt werden, weil er heute eine ganz andere Bedeutung als früher hat.
Wir verstehen unter der „Hausfrau” meistens eine Mutter, die zu Hause bei ihren Kindern bleibt. Das ist aber eigentlich nicht das gleiche. Früher war eine Hausfrau eine Frau, die sich in ihren Tätigkeiten auf ihr Haus und den dazugehörigen Ehemann konzentrierte. Eine verheiratete, nicht erwerbstätige Frau also. Dass Kinder zum Paket gehörten, war einfach selbstverständlich, genau wie der Anspruch, dass die Hausfrau sich um alte und kranke Familienmitglieder zu kümmern hatte.
Im Zentrum ihres Alltags standen die Kinder keineswegs. Wenn man einer Hausfrau vor hundert Jahren gesagt hätte, dass sie den halben oder ganzen Tag ihren Kindern widmen und dafür sorgen sollte, dass diese nicht unterfordert oder gelangweilt sind, hätte die Frau das für einen schlechten Witz gehalten. Sie hatte schließlich einen Haushalt zu besorgen. Die klassische Hausfrau hat einen anspruchsvollen Job, in dem nur Multitalente richtig gut sind. Schon Martin Luther hat in seinen Tischreden beschrieben, wie der Alltag seiner Frau Katharina von Bora aussah: Sie braute Bier, buk Brot, kümmerte sich um das Vieh und die Angestellten und sorgte täglich dafür, dass zwanzig Menschen an ihrem Mittagstisch satt wurden.
Selbst unsere Großmütter waren noch den ganzen Tag mit den berühmten fünf K beschäftigt „Kammer, Kleider, Küche, Keller, Kinder”. In diesem Sinne ist Bronsky keine Hausfrau im klassischen Sinne. Denn sie bleibt nach eigener Aussage zu Hause, weil sie für ihre Kinder da sein will, nicht für Kammer oder Kleider. Sie ist also mehr „schreibende Mutter” als „schreibende Hausfrau”.
3. Gibt es heute also überhaupt noch Frauen, die man im klassischen Sinne Hausfrau nennen könnte? Das ist schwer zu sagen. Denn die Zahlen, die man den Statistiken entnehmen kann, geben nur darüber Aufschluss, wie viele Frauen im erwerbsfähigen Alter zu Hause sind. Das sind in Deutschland etwa sechs Millionen. Von denen wahrscheinlich die wenigsten mit der Bezeichnung „Hausfrau” einverstanden wären. Weil dieser Tätigkeit hartnäckig die Anerkennung verweigert wird.
Paradoxerweise hat die „Hausfrau” so etwas mit der „Feministin” gemeinsam. Die meisten Frauen wollen explizit weder als das eine noch als das andere bezeichnet werden, weil sie die damit einhergehenden Klischees (unterdrückt, frustriert, ausgebeutet beziehungsweise männerhassend, frustriert, humorlos) nicht mögen. Das ist schade. Während aber mehr und mehr Frauen und manche Männer es wieder wagen, sich zum Feminismus zu bekennen, ist der Ruf der Hausfrau nach wie vor ziemlich schlecht. Sogar der Hausfrauenverband heißt „Netzwerk Haushalt”, um mehr nach Business zu klingen. „Reclaim the Hausfrau!”, ist ein Ruf, der gerne mal durch die Straßen tönen dürfte.
4. In Deutschland sind mehr Frauen als jemals zuvor erwerbstätig. Das klingt nach einer großen Errungenschaft – und ist es auch ganz klar, wenn man die Wahlmöglichkeiten, die Frauen heute haben, mit denen von 1950 vergleicht. Was aber oft übersehen wird, ist eine schmerzliche Ironie: Die Arbeit, die in Deutschland früher von Hausfrauen erledigt wurde, wird heute größtenteils immer noch von Frauen gemacht. Von schlecht bezahlten, häufig auch ausländischen Frauen. Sie putzen unsere Häuser und Wohnungen (nur etwa 10 Prozent der Menschen, die private Haushalte reinigen, sind Männer), arbeiten in Kitas (95 Prozent der Erzieher sind Frauen) und pflegen unsere Alten (etwa 85 Prozent der Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen sind weiblich). Diese Jobs heißen nicht grundlos immer noch „Frauenberufe“.
Es ist wichtig zu verstehen, dass Gleichstellung nicht automatisch passiert, wenn mehr Frauen in Führungspositionen und an Arbeitsplätzen sitzen. Denn in einem wichtigen Punkt hat sich weibliche Diskriminierung seit den 70ern überhaupt nicht geändert. Was heute vielleicht stärker denn je diskriminiert wird, und zwar bei Männern und Frauen, sind Eigenschaften und Lebensweisen, die in unserer Kultur traditionell eher als weiblich gelten: Fürsorge, Hingabe, Selbstlosigkeit, Familienarbeit, Häuslichkeit. Das ist nicht selbstverständlich. Warum bewerten wir es als Privatvergnügen, einen Kindergeburtstag auszurichten oder sich politisch zu engagieren, und warum bekommt man im Gegensatz Geld dafür, wenn man in einer Unternehmensberatung arbeitet?
Die US-amerikanische Feministin Nancy Fraser wirft dem heutigen Feminismus vor, dass er zum Handlanger des Kapitalismus geworden sei. Es geht demnach gar nicht mehr darum, Frauen und Männern die gleichen Rechte zu verschaffen, sondern die Arbeiten, die früher Frauen gemacht haben, abzuwerten und von denen verrichten zu lassen, die entweder mit so viel Liebe dabei sind, dass sie es freiwillig tun, oder die keine Wahl haben. Der Rest der Bevölkerung wird gleichberechtigt im Interesse der Wirtschaft eingespannt. So sieht das auch Bronsky: „Natürlich gibt es den Elternwunsch nach Betreuungsplätzen. Doch zugleich hat die Politik die Anforderungen, die eigentlich die Wirtschaft an die Bevölkerung stellte, aufgegriffen und so verdreht, dass sie als Fürsorge verkauft wurden. Mütter sollten mehr arbeiten, daher hieß es: Wir schaffen jetzt Krippenplätze, um die armen Frauen vom Herd loszureißen … Einen Feminismus, der sich ausschließlich für die Rechte der arbeitenden Frau einsetzt, halte ich für frauenfeindlich.” Amen, Sister.
5. Revolutionär? Wirklich? Weil man zu Hause bei seinen Kindern bleibt? Gut, man schwimmt damit irgendwie gegen den Strom, vor allem, wenn man, wie Bronsky, (noch) jung, gebildet und mittelschichtig ist. Von solchen Frauen werden andere Dinge erwartet: Auf den Plätzen 1 bis 3 der Prioritätenlisten haben Job, ökonomische Unabhängigkeit und Selbstverwirklichung zu stehen. Und da Hausfrau sein zwar viel Arbeit macht, aber kein „richtiger” Job ist, weil man damit kein Geld verdient, bürstet man mit einem solchen Lebensentwurf gegen den Strich der Zeit. Und das hat durchaus umstürzlerisches Potenzial.
„Revolutionär”, sagt der Duden, ist „jemand, der auf einem Gebiet als Neuerer auftritt”. Insofern hat Bronsky recht. Da es nun keine Sensation mehr ist, wenn Frauen arbeiten gehen, muss man jetzt zu Hause bleiben, um aus der Rolle zu fallen. Es ist eine interessante Eigenart der Frauenbewegung, dass sie immer wieder Dogmen zu zerbrechen scheint, sie aber in Wirklichkeit nur umdreht. So dass man sie dann wieder zerschlagen muss. Früher mussten Frauen zu Hause bleiben – heute „müssen” sie arbeiten. Früher hatten sich um Kinder und Kammer zu kümmern – heute sollen sie den Nachwuchs in Kitas geben und Putzfrauen anstellen. Früher mussten sie keusch bleiben – heute haben sie sexuell befreit zu sein. Und so weiter.
Echte Emanzipation herrscht natürlich auf keiner Seite des Extrems, sondern in der Freiheit, sich selbst irgendwo auf dem Spektrum zwischen Heimchen am Herd und im Vorstand eines DAX-Unternehmens zu verorten. Auch eine schöne Utopie: Eine Gesellschaft, in der man sich verändern darf, in der man viel flüssiger aus Familienzeiten in Jahre des Berufs wechseln könnte und wieder zurück. Ohne, dass jemand mit unlöschbarer Tinte Stempel wie „Hausfrau” oder „Karrierist” auf die Person knallt. Eine in dieser Weise gelassenere Gesellschaft täte nicht nur Frauen, sondern auch Männern gut.