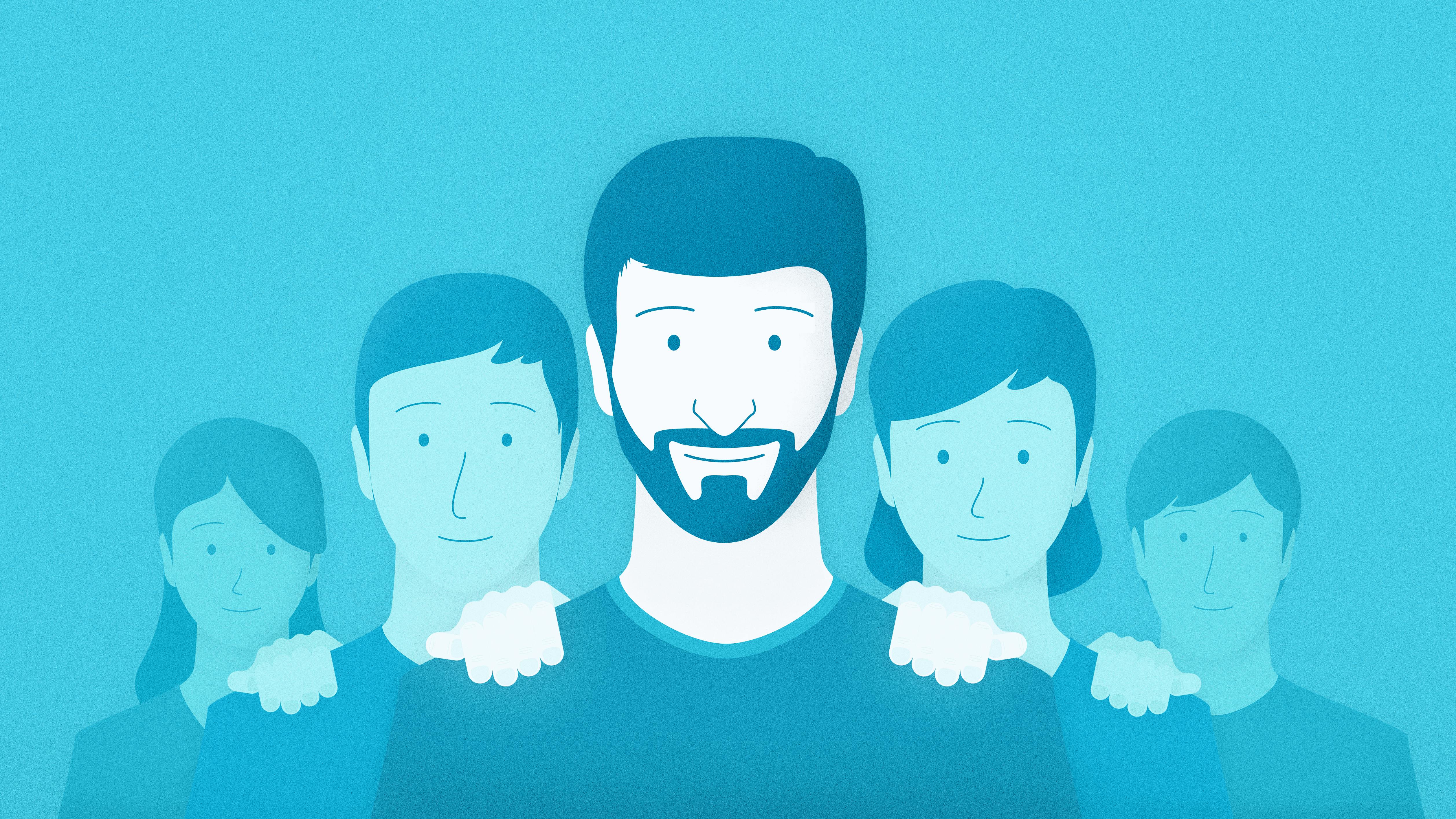Boris Woynowski, 33, ist gerade zum zweiten Mal Vater geworden. Deswegen ist er nicht immer gut zu erreichen. Aber Woynowski ist sowieso niemand, der den ganzen Tag am Schreibtisch oder in Telefonnähe sitzen würde. Viel wichtiger ist ihm: Zeit zu haben. Für seine Familie, ein gutes Leben, was für ihn bedeutet: ein ökologisch und sozial nachhaltiges Leben. Aber wie lässt sich das umsetzen in unserer Gesellschaft, die sich vor allem über Arbeit und Leistung definiert?
Genau das fragte Boris sich auch, der heute als Projektmanager in Kiel arbeitet. Zwanzig Stunden pro Woche, mehr nicht. Boris schmiss sein altes Leben hin, um einer Idee nachzugehen. Einem Projekt, von dem alle etwas haben würden, das der Gemeinschaft zugute käme: Ein Verein, der sich mit dem Thema Postwachstum beschäftigt.
Doch dafür brauchte er Geld – und entwickelte ein Crowdfunding der besonderen Art: Boris ließ sich von Freunden und Familie mehrere Monate lang den Lebensunterhalt finanzieren, um sich ganz auf die Gründung des Vereins und des Netzwerkes konzentrieren zu können. „Friendraising“ nennt Boris das. Schlau oder dreist? Das habe ich ihn gefragt – und, wie er es geschafft hat, bei seiner waghalsigen Idee keine Angst zu haben.
Boris, du hast dir für mehrere Monate von Freunden den Lebensunterhalt bezahlen lassen. Ziemlich praktisch, oder?
Bezahlen würd ich’s nicht nennen; das klingt so nach Produkt oder Dienstleistung. Ich würde eher sagen: Ich habe mir Geld geliehen. Es ging mir damals um meine Person, aber auch um ein klares gemeinnütziges Ziel. Ich habe eine Option verkauft: die Beteiligung an dem Gefühl, etwas zu tun, das der Allgemeinheit zugute kommt.
Die Idee des „Friendraising“, wie du es nennst, ist, sagen wir mal: ungewöhnlich. Wie bist du darauf gekommen?
An der Universität in Freiburg habe ich im Rahmen einer Doktorarbeit daran geforscht, wie das Wissenschaftssystem aussehen müsste, damit es transformativ wäre. Damit Wissenschaft also nicht nur Theorie betreibt, sondern wirklich auch zum Akteur wird. Die Frage, die ich dabei mit mir herumtrug, war: Wie kann man gut arbeiten und gleichzeitig gut leben? Aber an der Uni fiel mir irgendwann auf: Theorie und Realität passen überhaupt nicht zusammen. Einerseits ging es in meiner Forschung darum, dass es besser für den Menschen ist, nur 20 Stunden pro Woche zu arbeiten, sich biologisch zu ernähren und Zeit für seine Kinder zu haben – anderseits erwartete man von mir, dass ich mindestens 40 Stunden pro Woche arbeitete.
Das ist allerdings ein Widerspruch.
Ich bekam immer stärkere Zweifel. Angefangen hatte das eigentlich schon nach dem Ende meines Studiums, vor der Doktorarbeit. „Du bist hier falsch“, so hat es sich angefühlt. „Es muss doch noch etwas anderes geben“, dachte ich. Im selben Jahr, 2012, fuhr ich im Sommer mit einem Freund zur Fusion, das ist ein mehrtägiges Musikfestival. Dort erlebte ich einen abgefahrenen MDMA-Trip. Bitte nicht falsch verstehen: Darauf bin ich nicht stolz und ich will einen solchen Trip auch nicht weiterempfehlen …
Aber?
Für mich war das eine total spannende Erfahrung. Als Wissenschaftler war ich sehr im Kopf zu Hause, also gewohnt, die Dinge rational anzugehen. Aber dieser Trip brachte mich vollkommen zurück auf eine emotionale Ebene. Es öffnete sich für mich ein Raum.
Was genau heißt das?
Der Trip verschaffte mir Zugang zu der emotionalen Antwort auf die Frage „Was ist denn eigentlich wichtig für mich selbst?“ Er verstärkte das Gefühl, an der Uni falsch zu sein. Und den Gedanken: „Geh mal ganz raus, hör auf mit der Doktorarbeit in Freiburg!“ Parallel kam mir die Idee, ein Hausprojekt mit Gleichgesinnten zu starten. Schon ein Jahr vorher hatte ich mir eine Auszeit genommen und zwei Monate in der Bergbauernhilfe auf verschiedenen Höfen in Südtirol gearbeitet. Das war super, so ganz klischeemäßig die Hände in den Dreck zu stecken. Aber irgendwann fehlte mir das Intellektuelle dann doch. Ich dachte: „Es wäre doch toll, beides zu haben. Natur und Denkarbeit.“
Nach dem Trip kam mir die Idee für einen Ort, an dem Leute zusammenkommen und darüber nachdenken, wie man ein besseres, ökologisch nachhaltigeres und bewussteres Leben haben kann. Nicht nur auf theoretischer Ebene, sondern in einem kontinuierlichen Prozess, der aus Ausprobieren und Scheitern besteht. Dafür wollte ich ein Netzwerk gründen, einen Verein. Als Plattform für Gleichgesinnte.
Das klingt so ein bisschen nach dem alten Traum vom Leben in der Kommune. Hast du das dann wirklich umgesetzt?
Ich versuchte zunächst, den Gedanken auf einer niedrigen Stufe privat umzusetzen: Mit ein paar Freunden, so sechs, sieben Leute waren das, versuchte ich, meine Idee als Hausprojekt hochzuziehen. Ich war gut vernetzt und erfuhr von einer Gruppe in Leipzig, die etwas Ähnliches wollte. Wir fuhren hin, eine Gruppe aus Berlin war auch noch da. Auf dem Treffen wurde dann erstmal ziemlich kontrovers diskutiert. Und wir merkten schnell: Die Antwort auf die Frage nach dem guten Leben kann wirklich sehr unterschiedlich ausfallen. Am Ende bildeten sich zwei Lager: Die einen wollten raus aufs Land, und dort ein Haus kaufen – die anderen sagten: „Der Gedanke ist ja ganz süß, aber damit ändert ihr nichts, denn ihr zieht euch von der Gesellschaft zurück. Wir müssen das in der Stadt machen!“ Diese Gedanken fanden bei mir am meisten Resonanz, das hörte sich für mich stimmig an.
Trotzdem war’s ja noch ein weiter Weg bis zum Friendraising.
Ja. Dazwischen lag eine ziemlich krasse Erfahrung, die für mich immer noch schwer zu beschreiben ist. Aber es war irgendwie der Startschuss für mich, das klare Zeichen, Freiburg zu verlassen.
Und diese krasse Erfahrung sah wie aus?
Ich hatte eine Einladung zu einem Workshop bekommen, da sollte es um die Themen Work-Life-Balance und Achtsamkeit gehen. Als Teil des Workshops wurde eine Schwitzhütte gemacht.
Keine Angst – nur Glück und das Gefühl, das Richtige zu tun
Was ist das denn?
Der Shit ist das! Es ist ein bestimmtes Ritual: Du zündest gemeinsam mit anderen Leuten ein Feuer, legst Steine hinein und baust etwas abseits eine Hütte. Da sitzt du dann, nackt, komplett im Dunkeln, ab und zu trägt jemand heiße Steine herein. In meinem Fall saßen in der Hütte um mich herum lauter hoch gezüchtete Akademiker, so um die 30, die sich normalerweise ihre Veröffentlichungen um die Ohren hauten. Ich saß also in diesem dunklen Loch und hatte das Gefühl, jeden Moment vor Hitze zu ersticken, weswegen ich mein Gesicht möglichst nahe an den Boden drückte, um irgendwie noch Luft zu bekommen. Es wurde immer heißer, ich verlor mein Körpergefühl. Alles, was ich mir rational in meinem Leben zurecht gelegt hatte, war auf einmal weg. Ich fühlte mich seltsam körperlos.
Um Himmels willen!
Die Zeit löste sich auf. Irgendwie bin ich irgendwann aus der Hütte wieder herausgerobbt. Und war so erleichtert, aus dem Scheiß wieder draußen zu sein. Da lag ich dann, völlig fertig – aber glücklich. Draußen vor der Hütte, in der Natur, über mir der Sternenhimmel. Ich fühlte mich unglaublich gut. Mein Körper musste durch die ganze Prozedur irgendwelche Glückshormone produziert haben, die flatterten mir förmlich aus den Ohren. Und in diesem Moment dachte ich: „Das hier ist wirklich wichtig in meinem Leben: Auf die Suche zu gehen, Fragen zu stellen. Aber nicht in einem wissenschaftlichen Rahmen. Weil mich das nicht glücklich macht.“ Ich hatte in diesem Moment zwar keine Antwort auf die Frage, was nun kommen sollte. Aber ich spürte: „Ich muss mich bewegen, in eine neue Richtung.“
Hattest du in diesem Moment Angst?
Eigentlich war es eher ein Gefühl von ziemlicher Gelassenheit.
Wo kam die her in jenem Moment?
Ich lag eben unter diesem Sternenhimmel, ich war total ruhig und entspannt und dachte: „Eigentlich muss man doch vor nichts Angst haben.“ Es war eine ganz starke emotionale Erfahrung, wie man sie so selten in seinem Leben hat. Alles war gut in diesem Moment für mich, ich spürte Unendlichkeit, aber auch: „Halt dich ran und guck, was dir Glück bringt und geh diesen Sachen nach.“ Dass ich andere Dinge auf diesem Weg zurücklassen würde, daran habe ich in jenem Moment gar nicht gedacht.
Doktorarbeit weg, Wohnung gekündigt, kein Geld mehr – endlich!
Klingt großartig, aber du hast danach offenbar nicht beschlossen, im Wald zu leben.
Im Gegenteil. Ich habe nach dem Ort gesucht, an dem ich mein neues Leben finden würde, bin nach Leipzig gefahren, nach Erfurt und dann nach Berlin. Und obwohl ich als gelernter Förster ja mehr so der Naturliebhaber bin, dachte ich in Berlin, als ich mit der U1 am Schlesischen Tor vorbeigefahren bin: „Moment, hier muss ich hin!“
Ausgerechnet! Am Schlesischen Tor ist ja nun wirklich nicht viel mit Natur!
Ich weiß auch nicht, aber ich hatte eben dieses Gefühl. Also fuhr ich zurück nach Freiburg, sagte meinem Doktorvater, dass ich meine Doktorarbeit nicht weiterschreiben und mein Stipendium kündigen würde. Danach habe ich auch noch meine Wohnung gekündigt, ohne, dass ich schon etwas Neues in Berlin hatte und ohne zu wissen, wie ich mein neues Leben, meine Suche nach dem Glück, überhaupt finanzieren sollte.
Ganz ehrlich: Bist du an diesem Punkt nicht nochmal ins Wanken gekommen?
Nee, da war keine Angst. Ich hatte, warum auch immer, ein Selbstvertrauen, das über pure Euphorie hinaus ging, Ich konnte es mir auch nicht rational erklären; rational betrachtet war es sogar hirnrissig. Bekloppt. Nach sieben Jahren Studium alles hinzuschmeißen und dann auch noch das Stipendium! Aber tief in mir drin fühlte es sich richtig an. Und Berlin schien mir genau der richtige Ort zu sein.
Aber du brauchtest Geld.
Ja klar. Das Stipendium war tot, Hartz IV wollte ich nicht, und jobben ging ja nicht, weil ich hauptamtlich daran arbeite wollte, mein Projekt hochzuziehen, den Verein „Netzwerk Wachstumswende“. Der sollte erstens Menschen zusammenbringen, die sich mit wachstumskritischen Fragen auseinandersetzen. Also zum Beispiel: Muss Wirtschaft wirklich immer weiterwachsen? Muss es immer höher, schneller, weiter gehen? Zweitens wollte ich mit dem Verein auch konkret Projekte entwickeln, so wie beispielsweise 2014 die Degrowth-Konferenz in Leipzig. Ich habe mich damals mit meiner Idee bei zwei Stiftungen beworben, bin bei beiden aber gescheitert. Ich habe dann ein paar Freunde angeschrieben, von denen ich wusste, die sind finanziell gut aufgestellt und fänden so einen Verein klasse. Das waren so sieben, acht Leute, inklusive meiner Eltern.
Wie verändert Geld private Beziehungen?
Wie hast du die Leute ausgesucht, die dich letztlich finanziert haben?
Ich habe jene Menschen in meinem Umfeld gefragt, die mir am nächsten standen. Menschlich, aber auch thematisch. Zu denen habe ich gesagt: „Pass auf, ich bin dein Direktinvestment, deine Direkt-Aktie. Dafür, dass du mir Geld gibst, kümmere ich mich um die Umsetzung der Idee. Um die nötige Kohle, um eine Homepage, um das Netzwerk, um die nötige Infrastruktur. Unser gemeinsames Vorhaben, den Verein, realisierst du durch meine Arbeitskraft. Es ist auch egal, wie viel du geben würdest. Einfach ein Betrag, mit dem du dich gut fühlen würdest.“
Als Kritiker könnte man aber sagen: Das, was du vorhattest, war deine eigene bezahlte Sinnsuche.
Nee, das ist zu platt. Sinnsuche hat sowas Unbestimmtes, nach dem Motto: „Pass mal auf, ich hab keine Ahnung, was ich eigentlich machen will. Aber ich guck mal und du sollst mich bezahlen.“ Aber so war es ja nicht – die Sinnsuche hatte ich quasi schon abgeschlossen. Ich wusste ja, was ich nun wollte, hatte etwas im Gepäck, von dem ich dachte: „Das ergibt Sinn.“
Was war der kleinste und was der größte Betrag, den die Leute dir gegeben haben?
Das ging von 10 bis 150, 200 Euro pro Person.
Und wie viel Geld hattest du dann als Lebensgrundlage zusammen pro Monat?
Um die 380 Euro.
Das ist aber trotzdem sehr wenig.
Mir hat es für die wichtigsten Ausgaben gereicht, also für die Miete, günstiges Essen. Ab und zu habe ich einen Vortrag gehalten, über Wachstumsökonomie. So einen Referentenhonorar liegt etwa bei 200 bis 300 Euro. Außerdem habe ich viele Dinge verkauft, um über die Runden zu kommen. Zum Beispiel ein ziemlich gutes Mountainbike. Reich wurde ich mit alldem nicht, aber von 500 bis 600 Euro im Monat kann man in Berlin gut leben, und das habe ich so acht Monate gemacht. Bis ich eine Anstellung bei einer Agentur gefunden hatte, die später auch die Homepage für meinen Verein gebaut hat – und die passenderweise „Sinnwerkstatt“ heißt.
Das klingt jetzt in deiner Erzählung alles so leicht. Aber hast du dir keine Gedanken darüber gemacht, dass Freundschaft und Geld nicht immer so einfach zusammen geht? Es entstehen doch Abhängigkeiten; vielleicht fanden deine Freunde es auch nicht überzeugend, wie du ihr Geld verwendet hast.
Ich habe versucht, diese Möglichkeit abzufangen, indem ich meine Geldgeber einbezogen habe. Ich habe zum Beispiel einen Blog geschrieben, in dem ich jeweils ein Monatsfazit zusammentrug über meine Fortschritte und die Entwicklung des Vereins. So dass jeder nah bei dem Projekt dabei sein und sehen konnte: Ich schaffe hier wirklich was und werde nicht fürs Rumsitzen bezahlt. Sondern mir ist das ernst.
Was war das für ein Gefühl, von Freunden bezahlt zu werden?
Für mich hat sich das nicht nach Bezahltwerden angefühlt. Das Geld war auch nicht der springende Punkt – sondern das Vertrauen der Leute in mich. Dieses Zutrauen, nach dem Motto: „Mach das, wir unterstützen dich und geben dir einen kleinen Betrag für deine Idee!“
Fehlt es generell an einem solchen Zutrauen in unserer Gesellschaft?
Ich finde es schon wichtig, zu sagen: „Du hast eine Idee, du willst das machen? So what – probier’s aus!“ Jeder hat seine eigenen Gründe, sich nicht zu trauen, nicht zur eigenen Idee zu stehen. Aber viele Leute tragen mehr in sich und haben mehr Potenzial, als wir innerhalb des G8-Schulsystems, des Notenrahmens, der klassischen universitären Ausbildung oder eines Nine-to-Five-Jobs realisieren können. Bildung und Sozialisation sind die Raster, die Mauern hochziehen. Aber man sollte auch mal die Mauer überspringen und schauen, was auf der anderen Seite liegt. Sich an die Träume erinnern, die einem als Kind von den Erwachsenen ausgeredet wurden.
Vielleicht ist es ja gut, mal auf die Fresse zu fliegen
Klingt toll in der Theorie – ist aber in der Praxis superschwer.
Klar, je älter man wird, desto schwerer wird es, mit dem inneren Kind, den ganz naiven Träumen und Wünschen, in Berührung zu kommen – wenn man nicht grade selbst Kinder hat oder wenn eben die Angst immer mitläuft. „Was ist, wenn das Unsinn ist, was ich da mache? Was ist, wenn ich scheitere?“ Aber letztlich ist es eben eine ganz elementare Sache, zu sagen: Ja okay, vielleicht fliege ich dann auch mal auf die Fresse – aber vielleicht tut das ja sogar auch mal gut. Denn auf die Fresse fliegen hilft auch, dass man den eigenen Stolz und die eigene Arroganz verliert. Und es hilft eben dabei, sich die Frage zu stellen: „Warum tue ich eigentlich die Dinge, die ich tue?“
In deinem Fall: Hat das Friendraising reibungslos geklappt? Oder gab es auch Zerwürfnisse?
Wir stehen alle noch in Kontakt …
In gutem Kontakt?
Ich wohne ja nicht mehr in Berlin; ich bin vor drei Jahren zu meiner Freundin nach Kiel gezogen. Im Verein bin ich auch nicht mehr in der Geschäftsführung aktiv, sondern ganz normal Mitglied im Netzwerk. Das hat mittlerweile 5.000 bis 6.000 Mitglieder. Akademiker, Aktivisten, Interessierte, die sich austauschen. Das letzte Projekt, das wir gemacht haben, hieß Fokus Wachstumswende und ist in diesem Jahr zu Ende gegangen. Dadurch, dass ich weggezogen bin, haben sich meine Freundschaften etwas verlagert. Das hat aber meiner Meinung nach nichts mit der Friendraising-Geschichte zu tun.
Fühlst du dich gar nicht verpflichtet? Zum Beispiel, die Kohle zurückzuzahlen, die du bekommen hast?
Nein. Die Geldfrage spielt bei uns, auch in Gesprächen, keine Rolle mehr. Und für mich hat das Experiment eher dazu geführt, dass ich selbst auch jemand anders unterstützen will. Ich hab zum Beispiel, als der Verein dann soweit stand und ich eine feste Stelle angenommen hatte und somit wieder Geld verdiente, einem anderen Freund finanziell geholfen, der in einer Übergangsphase steckte und knapp bei Kasse war.
„Ich bin entspannter geworden mit Geld“
Da schließt sich der Kreis – oder wie?
Meinem Kumpel war es total peinlich zu sagen: „Moment, ich könnte Hilfe gebrauchen“. Ich meinte dann nur zu ihm: „Hey, ich kann dir locker jeden Monat 50 Euro geben, nimm die einfach – und dann mach! Los!“ Mein Umgang mit Geld hat sich generell verändert. Ich war zum Beispiel mit einem Freund segeln, der hatte keine Kohle – aber ich hatte ja welche. Also meinte ich nur: „Hey, nimm das Geld einfach, ich bezahle das für uns, und lass uns zusammen eine gute Zeit haben.“
Das heißt, du bist großzügiger geworden?
Hm ja, wenn man es so nennen will. Für mich ist Geld ein soziales Gestaltungsmittel. Klar braucht man es in gewisser Hinsicht, nicht nur zum Leben jetzt, sondern auch für eine kapitalgedeckte Altersvorsorge. Aber man braucht auch eine soziale Altersvorsorge, Freunde, Familie. Ein soziales Netz. Und das kommt nicht von Geld, das einfach nur rumliegt. Ich arbeite zum Beispiel nicht Vollzeit, ganz bewusst. Das heißt: Ich habe viel weniger Geld als andere Menschen – aber viel mehr Freizeit. Zum Beispiel für meine Familie.
Wie hat dich dieses Experiment sonst noch verändert?
Ich bin entspannter geworden. Ich weiß: Dinge werden sich fügen, wenn man sich in die richtige Richtung bewegt. Ich gehe zum Beispiel jetzt erstmal ein Jahr in Elternzeit. Das ist eine haarige Angelegenheit, da könnte ich denken: „Ui, ui, ui.“ Weil ich nicht weiß, wie es nach dem Jahr in dem Job dann wird. Aber deswegen gar keine Elternzeit nehmen? Die ganze Zeit Angst haben?
Stimmt, Angst zu haben, erzeugt nur Stillstand.
Manchmal ist sie ja auch hilfreich; man ist vorsichtiger. Aber man muss auch erkennen: Angst ist eine gedankliche Konstruktion. Und eben in vielen Fällen kein guter Ratgeber. Man muss sich überwinden. Sich trauen, auch mal verletzlich zu sein und zu sagen: „Hey, kann mir mal jemand hier helfen? Ich kann das hier grade nicht alleine!“ Das ist doch total okay.
Redaktion: Theresa Bäuerlein; Illustration: Peter Gericke; Schlussredaktion: Efthymis Angeloudis